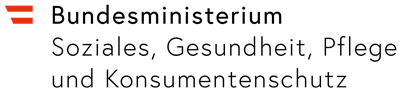Der Kläger schloss im Mai 2005 mit der beklagten Bank einen endfälligen CH-Fremdwährungskreditvertrag (FWK). Es wurde ein variabler Zinssatz vereinbart: Als Zinsanpassungsklausel wurde der 3-Monats-LIBOR (Indikator) zuzüglich eines fixen Aufschlags von 1,250 % vereinbart. Bei einem weiteren Kredit (in Euro) zwischen den Streitparteien wurde ebenfalls ein variabler Zinssatz vereinbart und zwar gekoppelt an den 3-Monats-Euribor (Indikator), beginnend mit 4% als Ausgangszinssatz. Bei Abschluss der Kreditverträge haben die Parteien nicht daran gedacht, dass die vereinbarten Referenzzinssätze Libor und Euribor jemals einen negativen Wert haben würden. Der Libor war im Dezember 2014 erstmals negativ. Am 10. 7. 2015 betrug der 3-Monats-Libor für Schweizer Franken -0,779 %. Der Euribor wies erstmals im Mai 2015 einen negativen Wert von -0,007 % auf.
Die beklagte Bank hatte angekündigt, den Referenzwert bei einem negativen Indikator mit Null anzusetzen und ihm damit den gesamten Zinsaufschlag zu verrechnen. Der Kläger begehrt daher die Feststellung, dass die beklagte Partei bezüglich beider Kreditverhältnisse nicht berechtigt sei, den für die Höhe des variablen Kreditzinssatzes relevanten Indikator bei negativer Entwicklung von Referenzzinssätzen mit Null anzusetzen.
Im konkreten Verfahren ging es daher um die Frage, ob der Kreditgeber bei einem negativen Referenzzinssatz berechtigt ist, den Indikator mit Null anzusetzen. Die Frage ist also, ob der zu leistende Zinssatz bei einem negativen Referenzzinssatz gegebenenfalls bis Null gesenkt werden muss oder der Kreditgeber in einem solchen Fall den Indikator bei Null ansetzen darf, sodass der Kreditnehmer wenigstens den vereinbarten Aufschlag zahlen muss. Es ging nicht darum, ob der Kreditgeber für die Zurverfügungstellung von Kapital ein Entgelt ("negative Zinsen") zahlen muss. Eine allfällige Verpflichtung der Bank zur Zahlung von "negativen Zinsen" musste hier nicht untersucht werden (vgl dazu im Zusammenhang mit § 28a KSchG zuletzt 10 Ob 13/17k).
Der OGH schließt sich hier jenem Teil der Lehre an, der die Ansicht ablehnt, dass sich im Wege der Vertragsauslegung ein derartiger Mindestsollzinssatz in Höhe des Aufschlags begründen lässt.
Eines Rückgriffs auf die ergänzende Vertragsauslegung bedarf es nicht. Ein solcher kommt dann in Betracht, wenn nach Vertragsabschluss Probleme auftreten, die die Parteien nicht bedacht und daher nicht geregelt haben. Für die Anwendung der ergänzenden Auslegung reicht es noch nicht hin, dass die Vertragsparteien an einen bestimmten Umstand nicht gedacht haben (hier: negativer Wert der Referenzzinssätze). Es ist vielmehr erforderlich, dass zur Lösung von Problemfällen auch keine Regelung getroffen wurde.
Das Berufungsgericht hat zutreffend darauf verwiesen, dass aufgrund des eindeutigen Wortlauts des Kreditvertrags von keiner Vertragslücke auszugehen ist, weshalb auch keine zu ergänzende Unvollständigkeit des Vertrags vorliegt. Weder aus dem Wortlaut noch aus dem Vertragszweck ergibt sich, dass die beklagte Bank mindestens den Aufschlag als Sollzinsen verlangen kann. Ein derartiger Mindestzinssatz würde sich hier somit mit dem tatsächlichen Parteiwillen in Widerspruch setzen, was eine ergänzende Vertragsauslegung ausschließt. Die Vertragsparteien haben die Chancen und Risiken zukünftiger Schwankungen der Finanzierungskosten vielmehr bewusst durch die Bindung des Sollzinssatzes an den Referenzzinssatz geregelt. Der Kreditnehmer, der einer Zinsänderungsklausel zustimmt und keinen Fixzinssatz wünscht, geht - auch für den Kreditgeber erkennbar - von einer symmetrischen Verteilung von Chancen und Risiken aus. Dem kann auch nicht die Höhe der Refinanzierungskosten der Bank entgegengehalten werden.
Zudem darf eine ergänzende Vertragsauslegung zu keinem gesetzwidrigen Ergebnis führen. Auch bei Annahme einer Lückenhaftigkeit der Zinsgleitklausel müsste die von der beklagten Partei vertretene (ergänzende) Vertragsauslegung am Symmetriegebot des § 6 Abs 1 Z 5 KSchG scheitern. Nach dem Zweck dieser Norm hat bei Zinsgleitklauseln eine Entgeltsenkung im gleichen Ausmaß und in der gleichen zeitlichen Umsetzung wie eine Entgeltsteigerung zu erfolgen, um den Verbraucherschutz zu gewährleisten. Ein weder aus dem Wortlaut der Kreditverträge noch dem Vertragszweck abzuleitendes Recht der beklagten Bank, den Indikator bei einem negativen Referenzwert einseitig mit Null anzusetzen und vom Kreditnehmer jedenfalls den Aufschlag zu verlangen, stünde im Widerspruch zu § 6 Abs 1 Z 5 KSchG, weil sich der Sollzinssatz dann nicht zu Gunsten des Konsumenten bis nach unten (nämlich bis Null) entwickeln kann, während nach oben eine entsprechende Grenze fehlt.
Nach Ansicht des OGH geht der entgeltliche Charakter des Kreditvertrags nicht schon dadurch verloren, dass der Kreditnehmer für eine gewisse Zeitspanne keine Zinsen zahlen muss. Im Hinblick auf die Rechtsnatur des Kreditvertrags als Dauerschuldverhältnis ist die Entgeltlichkeit hier schon deshalb zu bejahen, weil der Kläger zu Beginn des Vertragsverhältnisses eine Bearbeitungsgebühr und in den ersten Jahren des Vertragsverhältnisses auch Zinsen zahlen musste.
OGH 3.5.2017, 4 Ob 60/17b
Anmerkung: Wurde Kreditnehmern ein zu hoher Zinssatz (dh hier die gesamte Marge) verrechnet, können sie die zu viel gezahlten Zinsen zurückverlangen.