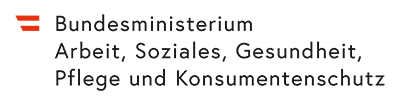Im Oktober 2001 bestellte ein Konsument über die Internetseite eines Unternehmers einen PC-Monitor um € 2.179,--. Für die Bestellung benutzte er ein Web-Formular. Dabei entschied sich der Konsument für die Abholung des Monitors im Geschäft des Unternehmers. Unmittelbar darauf erhielt er ein Antwort-Mail, in dem generelle Informationen enthalten waren und auf die Verbindlichkeit der Online Bestellung hingewiesen wurde. In einem zweiten E-Mail am selben Tag wurde der Konsument benachrichtigt, dass der Monitor in der folgenden Woche abholbereit ist. Zehn Kalendertage nach Abholung des Monitors brachte der Konsument das Gerät zurück und erklärte nach § 5e KSchG den Rücktritt vom Vertrag. Zu diesem Zeitpunkt wies das Gerät eine Betriebsdauer von 43 Stunden auf. Der Unternehmer verkaufte den Monitor in der Folge weiter und erstattete dem Konsumenten nur einen Betrag von € 1.499,--, dem Konsumenten verblieb dadurch ein Schaden in Höhe von € 680,--.
Der VKI klagte - im Auftrag des BMSG - den Unternehmer auf Rückzahlung des Betrages von € 680,--.
Nach Art. 6 Abs 2 der Fernabsatzrichtlinie (Fernabsatz-RL) dürfen einem Konsumenten im Falle eines Rücktrittes nämlich nur die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware auferlegt werden. Das Erstgericht wies das Klagebegehren allerdings unter Hinweis auf die Bestimmung des
§ 5g KSchG ab. Nach § 5g KSchG (welcher in Umsetzung der Fernabsatz-RL erlassen wurde) dürfen dem Konsumenten - entgegen Art. 6 Abs 2 Fernabsatz-RL - im Fall eines Rücktrittes sehr wohl ein Benützungsentgelt und eine Wertminderung verrechnet werden.
Das HG Wien beschäftigt sich als Berufungsgericht zunächst mit der Frage, ob und wann im konkreten Fall ein Vertrag im Fernabsatz zustande gekommen ist. Das HG Wien weist darauf hin, dass die auf einer Website angebotenen Waren kein Vertragsangebot im Sinn des § 861 ABGB darstellen. Vielmehr ist die Web-Darstellung nur als Aufforderung zur Stellung von Angeboten zu beurteilen. Die Bestellung des Konsumenten stellt somit ein Vertrags-Angebot dar. Für die weitere Beurteilung ist wesentlich, dass der Konsument die Ware im Geschäft des Unternehmers abholen wollte. Erfüllungsort sollte demnach das Geschäft des Unternehmers sein. In diesem Fall muss der Unternehmer die Leistung am Erfüllungsort bereitstellen. Durch die Benachrichtigung, dass das Gerät zu einem gewissen Zeitpunkt abholbereit ist, brachte der Unternehmer - zumindest konkludent - zum Ausdruck, dass er das Angebot annehmen möchte. Bei der Benachrichtigung von der Bereitstellung der Waren liegt im Sinn des § 863 ABGB kein vernünftiger Grund vor, am Rechtsgeschäftswillen des Unternehmers zu zweifeln.
In der Folge befasst sich das HG Wien mit dem Verhältnis zwischen Fernabsatz-RL und den Umsetzungsbestimmungen in den §§ 5a ff KSchG. Nach Ansicht des HG Wien soll das Rücktrittsrecht dem Verbraucher die Möglichkeit geben, nach Erhalt der Ware und deren Überprüfung vom Vertrag zurücktreten zu können. Damit würde dem Umstand Rechnung getragen, dass der Verbraucher im Fernabsatz die Leistung nicht unmittelbar in Augenschein nehmen kann. Durch das Rücktrittsrecht wird der Konsument einem Käufer, der die Ware vor Vertragsabschluss überprüfen kann, im Ergebnis gleichgestellt. Im Regelfall hat ein Käufer allerdings bei einem Kauf unter anwesenden Personen keine Möglichkeit, die Ware - außer zur Überprüfung der Mängelfreiheit - zu benützen. Die Fernabsatz-RL möchte den Verbraucher nach Ansicht des HG Wien für Fernabsatzgeschäfte nicht besser stellen als bei einem Kauf unter Anwesenden.
Das HG Wien meint weiters, dass die Fernabsatz-RL keinerlei Beschränkung eines bereicherungs-rechtlichen Ausgleiches enthalten würde, wenn sich der Verbraucher nach Überprüfung der Ware zu einer Benützung entschließt. Daher besteht für das HG Wien keine Veranlassung den Begriff "Kosten" in der Fernabsatz-RL so auszulegen, dass damit dem Verbraucher ein entgeltfreier Gebrauch der Ware bis zur Ausübung des Rücktrittsrechtes ermöglicht wird. Ein Widerspruch zwischen den Bestimmungen der §§ 5a ff KSchG und der Fernabsatz-RL liegt daher nach Ansicht des HG Wien nicht vor.
Danach setzt sich das HG Wien mit der Höhe des Benützungsentgeltes auseinander. Es verweist darauf, dass eine Orientierung am ortsüblichen Mietzins abzulehnen ist. Eine solche Orientierung würde nämlich bei Sachen, die auf lange Zeit üblicherweise nicht gemietet sondern käuflich erworben werden, zu unbilligen Ergebnissen führen. In solchen Fällen ist das Benützungsentgelt unter Berücksichtigung des Aufwandes zu ermitteln, den der Käufer hätte vornehmen müssen, um sich den Gebrauchsnutzen einer gleichwertigen Sache durch Kauf und Weiterverkauf zu verschaffen.
Eine Wertminderung, die nicht infolge ordentlicher Benützung der Sache durch den Verbraucher entsteht, sondern durch zufällige Ereignisse bewirkt wird, ist nach Ansicht des HG Wien bei der Berechnung des Benützungsentgeltes nicht zu berücksichtigen. Die im Erscheinen eines Nachfolgemodells liegende Wertminderung bleibt daher bei der Bemessung des Nutzungsentgeltes außer Bertacht. Im übrigen geht das HG Wien davon aus, dass die genaue Bestimmung des Benützungsentgeltes einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellen würde und setzt die Höhe des Benützungsentgeltes daher gemäß § 273 Abs 1 ZPO nach freier Überzeugung in Höhe von 15 % des Ankaufspreises - also € 330,-- - fest.
Der Unternehmer hat daher nach Ansicht des HG Wien eine berechtigte Gegenforderung in Höhe von € 330,--. Dementsprechend hat das HG Wien der Berufung des VKI teilweise Folge gegeben und den Unternehmer zur Rückzahlung von € 350,-- verurteilt.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der VKI wird zur Klärung der Auslegung des § 5g KschG im Verhältnis zur Fernabsatz-RL Revision an den OGH erheben.
HG Wien 2.12.2004, 50R 95/04h
Klagevertreter: Dr. Alexander Klauser, RA in Wien