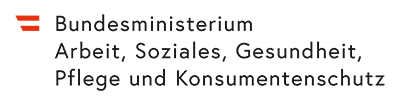Am 26.7.2001 haben wir die Gegenseite, ein Möbelhaus, auf Grund zwölf rechtswidriger Klauseln in deren Vertragsformblatt abgemahnt und aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Mit Schreiben vom 24.8.2001 verpflichtete sich das Unternehmen, die Klauseln 3), 5), 8), 9) und 12) nicht mehr zu verwenden; hinsichtlich der unter Punkt 6), 7), 10) und 11) gerügten Klauseln wurde eine Unterlassungserklärung ausdrücklich abgelehnt. Bezüglich der Klauseln 1), 2) und 4) war die Gegenseite bereit, die Fristen zu verkürzen und zwar bei der Klausel 1) von 4 auf 3 Wochen, bei den Klauseln 2) und 4) von 6 auf 4 Wochen.
Abgesehen davon war die Gegenseite nicht bereit, eine Unterlassungsverpflichtung auch hinsichtlich der Verwendung "sinngleicher Klauseln" einzugehen. Die Unterlassungserklärung war somit unvollständig, weshalb die Verbandsklage eingebracht wurde. Wir haben das Verfahren in zwei Instanzen rechtskräftig gewonnen.
Folgende Klauseln waren strittig:
1. Dieser verbindliche Antrag des Käufers gilt als angenommen, wenn er nicht innerhalb vier Wochen ab Antragsdatum seitens des Verkäufers abgelehnt wird.
Wir haben in der Klausel 1) einen Verstoß gegen § 6 Abs 1 Z 1 KSchG gesehen, da uns eine Frist von 4 Wochen, während der der Verbraucher an den Antrag gebunden bleibt, unangemessen lang erschien.
Unangemessen lange Frist
Das Erstgericht führte dazu aus, dass die Frage, wann eine Frist unangemessen lang ist, nicht abstrakt beantwortet werden könne. Es sei auf die Art des Geschäftes abzustellen. Als Grundsatz könne dabei gelten, dass die Bindung des Antragenden an das Angebot so lange dauern soll, wie die typischen Umstände (Übermittlung von Angebot und Annahme, Überlegungs- und Entscheidungsfrist für den Verwender unter Berücksichtigung dazwischen liegender Sonn- und Feiertage) es erfordern. Bei Kaufverträgen über bewegliche Sachen könne über ein Angebot in der Regel bald entschieden werden. Eine ohne sachlichen Grund merklich längere Bindung des Verbrauchers an sein Anbot schränke die Dispositionsfreiheit des Verbrauchers auf ungerechtfertigte Weise ein. Angesichts des heutigen Computer-Zeitalters, wo Lagerbestände, Preise, Liefermöglichkeiten etc. auf Knopfdruck abrufbar sind, beurteilte das Gericht sogar die von der Gegenseite vorgeschlagene dreiwöchige Frist als unangemessen lang.
2. Bei Überschreitung der Lieferfrist durch den Verkäufer vereinbaren die Vertragspartner, dass die vom Käufer gemäß § 918 ABGB zu setzende Nachfrist mindestens 6 Wochen zu betragen hat.
4. Zum Rücktritt ist der Käufer nur berechtigt, wenn er nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist die Lieferung schriftlich anmahnt und diese dann innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Mahnschreibens des Käufers beim Verkäufer nicht an den Käufer erfolgt.
Grobe Benachteiligung des Konsumenten
Auch die Klauseln 2) und 4) begründeten wir mit einem Verstoß gegen § 6 Abs.1 Z 1 KSchG, weil eine Nachfrist von mindestens sechs Wochen im Fall des Leistungsverzuges des Unternehmers zu lange ist. Das Gericht gab uns Recht: Selbst die von der Gegenseite reduzierte Nachfrist von 6 auf 4 Wochen in den Klauseln 2) und 4) wurde noch als unangemessen lange angesehen; im vorliegenden Fall insbesondere wegen der Ungleichbehandlung der Vertragspartner. Bei Verzug des Käufers sollte die Nachfrist nämlich nur eine Woche betragen, während sich der Verkäufer 4 Wochen vorbehält.
6. Kann der Kaufgegenstand zum vereinbarten Liefertermin vom Käufer aus irgendeinem Grund nicht übernommen werden, so ist jedenfalls die Zahlung des gesamten Auftragsbetrages bis zum vereinbarten Liefertermin des Kaufantrages fällig.
Die unter Punkt 6) vereinbarte Klausel wurde von uns als gröblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB beurteilt, da dadurch die Verzugsfolgen der §§ 918ff ABGB unzulässigerweise abbedungen werden. Ist der Kaufgegenstand mangelhaft, so hat der Käufer nach den Verzugsregeln das Recht, die Übernahme zu verweigern und den vereinbarten Kaufpreis bis zur Verbesserung nicht zu bezahlen.
Diese Klausel wäre nicht zu beanstanden - so das Gericht - wenn sie bloß auf den Annahmeverzug des Käufers abstellen würde. Im Verbandsklagsverfahren sei aber die kundenfeindlichste Auslegung heranzuziehen, sodass die Textierung der Klausel nicht bloß den Annahmeverzug decken würde. Nach dem Wortlaut der Klausel wäre der Käufer selbst im Fall einer mangelhaften Ware entgegen der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, den gesamten Auftragsbetrag zu bezahlen, was gröblich benachteiligend sei.
7. Der Verkäufer behält sich in diesem Falle vor: den entstandenen Schaden, jedoch mindestens 20% des Kaufpreises in Rechnung zu stellen.
10. Im Falle der Annahme der Stornierung wird der entstandene Schaden, jedoch mindestens 20% des Kaufpreises verrechnet.
11. Der Verkäufer ist berechtigt, im Falle des Verzuges des Käufers mit einer vertraglich festgelegten Geldleistung nach Setzung einer Nachfrist von einer Woche vom Vertrag zurückzutreten, in diesem Falle ist er zu Geltendmachung einer Konventionsstrafe von 20% des Kaufpreises berechtigt.
20 Prozent Storno sind zuviel
Zu den Klauseln 7),10) und 11) teilte das Gericht ebenfalls unsere Auffassung, dass eine generelle Stornogebühr von mindestens 20% des Auftragswertes für den Kunden gröblich benachteiligend sei. Dies deshalb, weil der Kunde diese 20%ige Stornogebühr auch dann zu zahlen habe, wenn der beklagten Partei aus der Nichtdurchführung des Geschäftes ein wesentlich geringerer oder gar kein Schaden erwächst. Eine Stornogebühr, die sich nicht am tatsächlichen oder durchschnittlichen Schaden orientiert, sei gröblich benachteiligend. Die beklagte Partei hatte nämlich nicht einmal behauptet, dass der durchschnittliche Schaden im Falle eines Stornos wenigstens 20% des Auftragswertes betragen würde.
Zur Ablehnung der Unterlassungserklärung hinsichtlich der Verwendung sinngleicher Vertragsklauseln führte das Gericht aus, dass damit die Wiederholungsgefahr bestehen bleibe. Nach ständiger Rechtsprechung müsse nämlich die Fassung eines Unterlassungsgebotes so beschaffen sein, dass dem Verbotspflichtigen nicht jede Umgehung allzu leicht gemacht werde. Dem könne nur dann entsprochen werden, wenn das Verbot auch auf die Verwendung sinngleicher Klauseln ausgedehnt werde, also auf solche, die denselben verpönten Regelungszweck zum Inhalt haben.