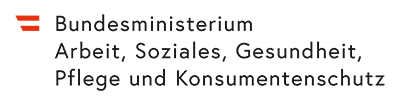I. Einleitung
FWK erfreuten sich lange Zeit großer Beliebtheit. Mittlerweile sind - verstärkt durch die Finanzkrise - die mit dieser Finanzierungsform verbundenen Risiken vermehrt zu Tage getreten: Einerseits besteht ein Währungs- bzw Wechselkursrisiko: Kommt es zu einer Aufwertung der Fremdwährung, erhöht sich der vom Verbraucher zurückzuzahlende Betrag. Das Risiko potenziert sich, weil die meisten FWK endfällig ausgestaltet sind, dh das Kapital muss erst zum Ende der Laufzeit getilgt werden; während der Laufzeit fallen nur Zinsen an. Die fremde Währung bringt zudem ein Zinsrisiko mit sich, weil sich die Zinsen der fremden Währung anders entwickeln können als jene des Euro. Zugleich wird meist ein Tilgungsträger (Aktien, fondsgebundene Lebensversicherungen) angespart, mit dem zum Ende der Laufzeit der Kredit zurückgezahlt werden soll. Verläuft die Wertentwicklung des Tilgungsträgers nicht wie erwartet, trifft den Verbraucher daher auch ein - häufig beträchtliches - Tilgungsträgerrisiko.
Zwei Problemkomplexe sind im Folgenden auseinanderzuhalten:
(1) Die große Zahl an noch laufenden FWK lässt sich in vielen Fällen darauf zurückführen, dass die Verbraucher von vornherein nicht ausreichend über die mit dieser Finanzierungsform verbundenen Risiken aufgeklärt wurden. In manchen Fällen wurden Verbrauchern die FWK auch regelrecht "aufgeschwatzt"; sie hatten gar keinen Finanzierungsbedarf, sondern wollten lediglich fürs Alter vorsorgen. Ist schon die Aufnahme des FWK auf eine Fehlberatung zurückzuführen, leidet der Kreditvertrag als solcher an einem ursprünglichen Mangel. Konsequenz sind - neben den iaR bereits verjährten (§ 1487 S 1 ABGB) irrtumsrechtlichen Anfechtungsmöglichkeiten - Schadenersatzansprüche des Verbrauchers gegen den Vermittler, die Bank und/oder - bei FWK mit Versicherungs-Tilgungsträger - die Versicherung. Dazu unter II.
(2) Zum Anderen können bei der Abwicklung des Kreditverhältnisses Störungen auftreten: Die Kreditverträge enthalten häufig Klauseln, die der Bank das Recht geben, auf Währungsschwankungen zu reagieren, Erhöhungen von Refinanzierungskosten zu überwälzen oder bei Wertschwankungen des Tilgungsträgers Anpassungen zu verlangen. Häufig vorgesehen sind insb Zwangskonvertierungen bei Überschreiten gewisser Wechselkursgrenzen, Refinanzierungs- und Liquiditätsaufschläge bei den Zinsen, sowie Sonderaufstockungen, Ausgleichszahlungen oder Nachbesicherungen bei einem Wertverfall des Tilgungsträgers. Die Zulässigkeit derartiger Klauseln ist am Maßstab von § 879 Abs 3 ABGB und § 6 KSchG zu messen. Dazu unter III.
II. Beratungsfehler
Wird im Vorfeld des Vertragsabschlusses nicht auf die mit FWK verbundenen Risiken hingewiesen, oder wird die Aufnahme von FWK empfohlen, obwohl dieser den Interessen des konkreten Verbrauchers von vornherein nicht entspricht (zB Altersvorsorge), können Schadenersatzansprüche des Verbrauchers bestehen, wenn der Verbraucher bei korrekter Information und Beratung den FWK in dieser Form nicht aufgenommen hätte, sondern keine oder eine andere, weniger risikoträchtige Finanzierungskonstruktion gewählt hätte.
Als Haftungsadressaten kommen vor allem die (selbständigen) Vermittler, Banken und Versicherungen in Betracht; in Hinblick auf Erwerb und/oder schlechte Performance des Tilgungsträgers auch der Emittent bzw die Gesellschaft (Prospekthaftung, fehlerhafte ad hoc-Publizität, Kursmanipulation [§ 11 KMG, § 48a ff BörseG] bzw qua Zurechnung).
Zur Zeit sind etliche Verfahren anhängig. Einige (höchstgerichtliche und rechtskräftige unterinstanzliche) Entscheidungen liegen zwar bereits vor; viele Fragen sind bislang aber höchstgerichtlich ungeklärt und auch in der Lehre nicht aufgearbeitet. Im Folgenden wird anhand der aktuellen Judikatur ein Überblick über die für Beratung und Rechtsdurchsetzung wesentlichen Eckpunkte gegeben.
A. Schadensberechnung
Hätte der Verbraucher bei ordnungsgemäßer Beratung keinen FWK aufgenommen, ist hinsichtlich des ersatzfähigen Schadens zu unterscheiden zwischen dem sog realen und dem rechnerischen Schaden. Die Differenzierung ist von entscheidender Bedeutung für Inhalt und Art der Geltendmachung des Ersatzanspruchs (dazu unter B.), die Verjährungsfrage (C.) und aus prozessrechtlicher Sicht vor allem für Zulässigkeit der Klage (B.) und Formulierung des Klagebegehrens.
1. Ein realer Schaden liegt nach nunmehr stRsp bereits darin, dass die Zusammensetzung des Vermögens nicht dem Willen des Anlegers entspricht (RIS-Justiz RS0022537, zB 6 Ob 145/08d; 3 Ob 198/11f). Bei FWK besteht der reale Schaden des Verbrauchers daher im Kreditvertrag bzw Finanzierungskonzept, das nicht seinem Willen bzw seinen Interessen entspricht (6 Ob 103/08b; HG Wien 53 Cg 83/11v [rk]; offen lassend aber 3 Ob 40/07i). Dieser Schaden tritt bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein. Zur Bedeutung für die Verjährung s unten.
Inhaltlich erfolgt der Ausgleich des realen Schadens durch Naturalrestitution (§ 1323 S 1 ABGB analog), die grundsätzlich schon ab Aufnahme des FWK mit Leistungsklage durchgesetzt werden kann.
Mit Naturalrestitution begehrt der Verbraucher vom Schädiger, real so gestellt zu werden wie er stünde, wenn ordnungsgemäß beraten worden wäre (alternativ: sog Geldersatz zur Naturalrestitution: Ersatz der Kosten zur Vornahme der Naturalrestitution durch den Geschädigten).
Worin diese genau besteht, hängt daher vom hypothetischen Kausalverlauf bei rechtmäßigem Verhalten des Schädigers ab. Typischerweise werden hier vor allem drei mögliche Szenarien in Betracht kommen:
(1) Der Verbraucher hätte gar keinen Kredit aufgenommen - etwa, weil dem FWK kein Finanzierungsbedarf zugrunde lag, sondern der Wunsch nach einer Pensionsvorsorge;
(2) der Verbraucher hatte einen Finanzierungsbedarf, hätte aber das mit FWK verbundene Risiko nicht in Kauf genommen und daher einen Euro-Ratenkredit aufgenommen oder
(3) der Verbraucher hätte einen tilgenden FWK aufgenommen, um Zins- und Währungsrisiko zumindest zu mindern.
Hätte der Verbraucher gar keinen Kredit aufgenommen, richtet sich die Naturalrestitution auf Aufhebung des Kreditvertrags mit schuldrechtlicher ex tunc-Wirkung und Abnahme des Tilgungsträgers (gegenüber dem Vertragspartner, zB der Bank) bzw auf Befreiung von Kreditschuld und Abnahme des Tilgungsträgers (gegenüber dritten Haftpflichtigen, zB dem Anlageberater). Hätte der Verbraucher statt eines FWK einen Euro-Ratenkredit oder einen tilgenden FWK abgeschlossen, kann er verlangen, jetzt so gestellt zu werden, als hätte er diesen abgeschlossen.
In all diesen Fällen kann die Naturalrestitution freilich zur Folge haben, dass der Verbraucher Geld nachschießen muss: Bei hypothetisch abgeschlossenen tilgenden Krediten sind die bereits fälligen Raten nachzuzahlen. Bei gänzlicher Aufhebung des Kreditvertrags sind - abzüglich etwaig entrichteter und verlorener Zahlungen an den Tilgungsträger - die erhaltenen Kreditvaluta zurückzuzahlen, für deren Behalten nach Auflösung des Kreditvertrags an sich kein Rechtsgrund mehr besteht (§ 1435 ABGB). In letzterem Fall käme nach unserer Auffassung allerdings nach dem Schutzzweck der verletzten Aufklärungspflicht und den Grundsätzen aufgedrängter Bereicherung (Nachteilsausgleich) im Einzelfall eine Streckung der - grundsätzlich sofort fälligen - Rückzahlungsverpflichtung in Betracht (vgl § 7 Abs 2 WucherG).
Noch offen ist nach derzeitiger Judikatur, ob die Naturalrestitution beim FWK überhaupt begehrt werden kann oder - vor allem gegenüber dritten Haftpflichtigen wie dem Anlageberater - aufgrund der Komplexität der Rückabwicklung infolge Unmöglichkeit/Untunlichkeit ausscheidet (idS zuletzt 3 Ob 49/12w; ebenso HG Wien 53 Cg 83/11v; 1 Ob 208/11m: Untunlichkeit auf Seiten des Schädigers [!] beim Bauherrenmodell).
2. Mit dem sog rechnerischen Schaden ist der Vermögensschaden des Verbrauchers gemeint. Ob ein solcher überhaupt eintritt, steht bei Vertragsabschluss noch nicht fest, sondern erst, wenn sich der FWK rein rechnerisch nicht mehr ohne zusätzliche Vermögensverminderung im Vergleich zum Alternativszenario entwickeln kann; in welcher Höhe er eintritt, steht überhaupt erst am Ende der Laufzeit fest. Bis dahin kann sich der rechnerische Schaden - je nach Entwicklung von Währungskurs und Tilgungsträger - sowohl nach oben als auch nach unten verändern. Er ist daher auch erst am Ende der Laufzeit ziffernmäßig bestimmbar und mit Leistungsklage einklagbar (§ 226 ZPO); davor käme insofern nur eine Feststellungsklage des Verbrauchers in Betracht. Dazu unten.
Berechnet wird der rechnerische Schaden stets subjektiv konkret unter Berücksichtigung des hypothetischen Kausalverlaufs: Seine Höhe ergibt sich aus einem Vermögensvergleich (Differenzmethode): Ersatzfähig ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögensstand des Verbrauchers nach Ablauf der Laufzeit und dem hypothetischen Vermögensstand im Alternativszenario. Auch hier kommt es daher entscheidend darauf an, was der Verbraucher hypothetisch bei ordnungsgemäßer Aufklärung gemacht hätte: gar kein Kredit, tilgender FWK, Abstattungskredit in Euro. Letzterer wurde als Vergleichsmaßstab zuletzt in mehreren rk E unterinstanzlicher Gerichte herangezogen (HG Wien 53 Cg 83/11v; LGZ Wien 24 Cg 69/09g).
Beachte: Für die Schadensberechnung ist essentiell, was der Verbraucher bei ordnungsgemäßer Beratung getan hätte. In vielen Fällen wird er dies vermutlich selbst nicht mit Gewissheit angeben können. Zu fragen ist daher nach dem Zweck der Aufnahme des FWK und der Risikobereitschaft des Verbrauchers: Gab es einen Finanzierungsbedarf (zB Eigenheim), der gedeckt werden musste? Wenn nicht, hätte der Verbraucher idR wohl gar keinen Kredit aufgenommen. Wenn ja liegt es nahe, dass er jedenfalls einen Kredit aufgenommen hätte. Dann kommt es darauf an, welches Risiko dem Verbraucher verschwiegen wurde. Wäre er gar kein Risiko eingegangen, liegt es nahe, dass er einen Euro-Abstattungskredit aufgenommen hätte. Wichtig ist freilich die Kontrollfrage, ob ein solcher überhaupt leistbar war. War ihm nur die Verschärfung des Risikos aus der Kombination Fremdwährung und Tilgungsträger unklar, wusste er aber über das Währungsrisiko Bescheid, kann es auch sein, dass er einen tilgenden FWK oder einen FWK ohne Tilgungsträger aufgenommen hätte.
3. Ersetzt wurde nach den bisher ergangenen Entscheidungen der unterinstanzlichen Gerichte lediglich dieser Differenzschaden. Abgewiesen wurden dagegen (Haupt-)Begehren auf Feststellung, dass über das Realisat aus dem angesparten Tilgungsträger hinaus keine weiteren Forderungen der Bank aus dem Kreditverhältnis bestünden (vgl auch OLG Wien 4 R 166/10a). Letzteres entspräche einer Garantie in Hinblick auf die erwartete Performance des Tilgungsträgers. Dass eine solche per se nicht angenommen werden kann, ist freilich aus der Jud nicht abzuleiten. Ob garantiert wurde, dass die Rückzahlung des Kredits zum Ende der Laufzeit nur aus den Erträgen aus dem angesparten Tilgungsträger erfolgt, hängt als Frage der Vertragsauslegung (§§ 914 f ABGB) vielmehr von den konkreten Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab.
Ist der Wortlaut der entsprechenden Formulierungen nicht eindeutig, wäre dabei die Zweifelsregel des § 915 Fall 2 ABGB heranzuziehen, die Klausel demnach zum Nachteil der Bank auszulegen. Die Bindung der Bank an entsprechende Aussagen des (externen) Vermittlers kann dabei einerseits bereits rechtsgeschäftlicher Natur sein (Garantie als Vertragsinhalt bei Einsatz eines Abschluss- oder Verhandlungsgehilfen) oder aber sie hat für dessen Aussagen schadenersatzrechtlich nach den Grundsätzen der Erfüllungsgehilfenhaftung (§ 1313a ABGB) einzustehen. Näher zur Zurechnung des Vermittlers an die Bank unten.
4. Der Umfang des zu ersetzenden Schadens hängt freilich stets davon ab, worin das rechtswidrige Verhalten des jeweiligen Ersatzpflichtigen besteht und für welche Dispositionen des Verbrauchers es kausal war (Kausalität der Pflichtwidrigkeit).
Beachte: Wurde die fondsgebundene Lebensversicherung, die dem Finanzierungskonzept als Tilgungsträger diente, im Einzelfall bereits vorher abgeschlossen, ohne dass der Erwerb durch die Aufnahme des FWK motiviert war, oder wäre sie - vom FWK unabhängig, daher auch ohne diesen - ohnehin abgeschlossen worden, scheidet eine Rückabwicklung des Tilgungsträgers qua Schadenersatz aus. Dieser ist dann vielmehr von der Ersatzpflicht ausgenommen. Dasselbe gilt für etwaige Immobilienaktien, die der Verbraucher bereits gehalten hat oder in die er auch bei ordnungsgemäßer Beratung investiert hätte.
Achtung: Dies gilt nicht, wenn der Tilgungsträger - wenn auch zeitlich vor Abschluss des Kreditvertrags - nur deshalb erworben wurde, weil er Teil des einheitlichen Finanzierungskonzepts ist! In diesem Fall ist auch die Kausalität regelmäßig zu bejahen.
Ein Problem des Rechtswidrigkeitszusammenhangs stellt sich, wenn Aufklärungspflichten der Bank nur das Fremdwährungs- oder Kombinationsrisiko betreffend bestehen und verletzt wurden, bei ordnungsgemäßer Aufklärung zwar auch der Tilgungsträger nicht erworben worden wäre, aber in Bezug auf diesen keine Aufklärungspflichten verletzt wurden (vgl 2 Ob 259/08i). Eine Haftung der Bank auch für Wertverluste aus dem Tilgungsträger ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn ihr fremdes Beraterverschulden in Ansehung des Tilgungsträgers zugerechnet werden kann. Dies ist nach neuester Judikatur schon dann der Fall, wenn zwischen Bank und externem Anlageberater Vertriebsvereinbarungen bzw ein wirtschaftliches Naheverhältnis bestehen (4 Ob 129/12t, dazu unten).
Darüber hinaus ist in der Jud noch ungeklärt, ob und wie ein etwaig fehlender Rechtswidrigkeitszusammenhang bei der Abwicklung von FWK zu berücksichtigen ist.
Nach unserer Ansicht wird in vielen Fällen die vom OGH in anderem Zusammenhang entwickelte "Risikoerhöhungstheorie" (4 Ob 62/11p) zur Zurechenbarkeit auch des TT-Wertverlusts an die Bank führen, sofern es sich um ein einheitliches Finanzierungskonzept handelte. Eigene Aufklärungspflichten auch über das TT-Risiko bestehen nach unserer Auffassung jedenfalls dann, wenn die Bank das kombinierte, einheitliche Produkt vorgeschlagen bzw entworfen hat; dasselbe gilt in Hinblick auf Risikoverschärfung und Fremdwährungsrisiko vice versa für eine etwaige Versicherung, die das Gesamtprodukt samt TT fondsgebundene Lebensversicherung entworfen hat. Dazu unten.
B. Rechtsdurchsetzung
1. Der Schadenersatzanspruch des Kreditnehmers richtet sich entweder auf Naturalrestitution oder auf Geldersatz. Grundsätzlich hat der Geschädigte die Wahl zwischen diesen beiden Arten des Schadensausgleichs. Geldersatz kann der Kreditnehmer allerdings wie oben erläutert erst am Ende der Laufzeit verlangen, weil aufgrund der möglichen Währungs-, Zins- und Wertschwankungen des Tilgungsträgers uU erst zu diesem Zeitpunkt feststeht, ob der Geschädigte überhaupt einen rechnerischen Schaden erlitten hat, vor allem aber, in welcher Höhe. Eine etwaig davor eingebrachte Leistungsklage auf Ersatz des rechnerischen Schadens wäre mit Urteil abzuweisen.
2. Naturalrestitution ist grundsätzlich bereits vor Laufzeitende, uzw ab Aufnahme des FWK möglich und ab diesem Zeitpunkt auch mittels Leistungsklage einklagbar. Ob alternativ dazu und in Hinblick auf den zum Ende der Laufzeit in der Zukunft allenfalls eintretenden rechnerischen Schaden auch eine Feststellungsklage zulässig ist, wird vom OGH zur Zeit nicht einheitlich beurteilt: Während der 6., 9. und 8. Senat die Feststellungsklage infolge Subsidiarität zur - bereits möglichen - Leistungsklage als unzulässig abwiesen (8 Ob 129/10v; 8 Ob 39/12m; 6 Ob 91/10s; 9 Ob 85/09d; 6 Ob 28/12d; 6 Ob 9/11h, tw auch unter Berufung auf das "Spekulationsargument"; anders aber noch 8 Ob 123/05d), entschieden der 1. und (obiter) 4. Senat gegenteilig (1 Ob 251/11k; 4 Ob 67/12z). Die Judikaturdivergenz kann für die typischen FWK-Fälle aber wahrscheinlich dahin stehen:
Jedenfalls zulässig ist die Feststellungsklage nämlich dann, wenn eine Leistungsklage vor Laufzeitende deshalb ausscheidet, weil die Naturalrestitution unmöglich oder (vor allem: für den Geschädigten!) untunlich ist. Letzteres ist nach dem OGH bei FWK mit Tilgungsträger (konkret: "Pensionsvorsorgemodell" mit Kreditvertrag, Rentenversicherung, fondsgebundene Lebensversicherung) schon aufgrund der Komplexität der Rückabwicklung der Anlageentscheidung der Fall; die Naturalrestitution sei wegen der Beteiligung Dritter mit besonderen Schwierigkeiten verbunden (3 Ob 49/12w; ebenso HG Wien 53 Cg 83/11v). Ob die Naturalrestitution hier überhaupt ausscheidet oder nur, wenn sie der Verbraucher nicht wünscht (idS 1 Ob 251/11k), ist in der Rsp derzeit noch ungeklärt. Die Tatsache allein, dass der Haftpflichtige nicht Vertragspartner, sondern Dritter ist, wurde in den klassischen Wertpapiererwerbsfällen von der Rsp jedenfalls bislang nicht als Hindernis der Naturalrestitution (Rückzahlung des Erwerbspreises Zug um Zug gegen Herausgabe der erworbenen Papiere) gewertet (zB 10 Ob 11/07a; 5 Ob 246/10b; 6 Ob 9/11h); eine Untunlichkeit der Naturalrestitution auf Seiten des Schädigers (!) aber zuletzt bei Abschluss eines "Bauherrenmodells" (Mitglied einer Gemeinschaft von Bauherrn, Miteigentümer einer Liegenschaft) bejaht (1 Ob 208/11m).
Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob der Verbraucher die Feststellungsklage auch einbringen muss, um eine Verjährung seines Ersatzanspruchs (dazu unten) zu verhindern. Das ist nach der derzeitigen Rsp noch offen. Nach unserer Ansicht wäre die Frage zu verneinen, weil der Schadenersatzanspruch schon nach der allgemeinen Regel des § 1478 ABGB nur verjähren kann, wenn die Geltendmachung irgendeines (Primär- oder realen) Schadens - uzw mit Leistungsklage! - überhaupt möglich war.
Beachte: Vor dem Hintergrund der unklaren Judikatur empfiehlt es sich, vorsichtshalber so rasch wie möglich, jedenfalls aber vor Ablauf von drei Jahren ab Kenntnis vom (realen) Schaden eine Klage einzubringen und nicht bis zum Ende der Laufzeit zu warten.
Aus derzeitiger Sicht sollte zusätzlich zum jeweiligen Hauptbegehren auf Feststellung oder Leistung (Naturalrestitution) vorsichtshalber das entsprechenden komplementäre Eventualbegehren erhoben werden.
C. Verjährung
Die mögliche Gefahr einer Verjährung des Ersatzanspruchs steht bei FWK naturgemäß stark im Vordergrund, erstreckt sich deren Laufzeit doch iaR über einen längeren (oft: jahrzehntelangen) Zeitraum. Schadenersatzansprüche verjähren aber in drei Jahren ab Kenntnis von Schaden und Schädiger (§ 1489 S 1 ABGB); daneben gilt eine absolute, dh kenntnisunabhängige Frist von 30 Jahren ab dem schädigenden Ereignis (§ 1489 S 2 Fall 1 ABGB). Erlangt der Verbraucher Kenntnis davon, dass der FWK entgegen den Zusicherungen des Beraters (höhere) Risiken birgt - oftmals infolge einer Verständigung der Bank über mögliche Deckungslücken oder Nachbesicherungs- und Konvertierungsbegehren -, wartet er aber die weitere Entwicklung von Währungskurs und Tilgungsträger ab, weil die Chance auf Erholung besteht, könnte sein Anspruch prima vista zum Ende der Laufzeit bereits verjährt sein.
Insofern ist bei der Beratung besondere Vorsicht geboten. Die bislang zu FWK ergangene Judikatur hat den Einwand der Verjährung zwar im Ergebnis stets verworfen; noch in keinem einzigen Fall wurde wegen Verjährung abgewiesen. Allerdings liegt nach derzeitigem Stand noch keine gesicherte Linie der Rechtsprechung vor.
Beachte: Wann hat der Verbraucher erstmals davon erfahren, dass es ein Problem mit dem Tilgungsträger bzw dem FWK gibt (zB durch Mitteilung der Bank)?
Achtung: Maßgeblich ist das Datum des Zugangs beim Verbraucher! Irrelevant ist, ob und wann er das Dokument gelesen hat (2 Ob 65/09m).
Sind seither nicht mehr als drei Jahre vergangen, ist dem Verbraucher zu raten, möglichst rasch einen Rechtsanwalt aufzusuchen, um etwaige Ansprüche prüfen zu lassen und vorsichtshalber eine Klagseinbringung vorzubereiten. Es ist nach der derzeitigen Judikatur nicht auszuschließen, dass zur Abwendung der Verjährung die Einbringung einer Leistungsklage auf Naturalrestitution oder einer Feststellungsklage verlangt wird.
Sind seit der Mitteilung an den Verbraucher mehr als drei Jahre vergangen, ist dem Verbraucher ebenfalls zu raten, einen Anwalt aufzusuchen, weil Schadenersatzansprüche noch nicht notwendig verjährt sind.
Einerseits ist nach derzeitigem Stand der Rsp möglich, dass der Fristbeginn später angesetzt wird, andererseits, dass die Naturalrestitution als untunlich verworfen und auch keine Feststellungsklage verlangt wird, sondern in diesem Fall erst der Eintritt eines rechnerischen Schadens bei Laufzeitende die Frist in Gang setzt. Zudem könnte immer noch die Möglichkeit der Aufrechnung bestehen.
Unserer Ansicht nach besteht die Gefahr der Verjährung aus mehreren Gründen nicht: Zum Einen innerhalb des Verjährungsrechts strenge Handhabung des Kenntniskriteriums in Hinblick auf den Eintritt des realen Schadens ; Fristbeginn erst mit Eintritt des rechnerischen Schadens = am Ende der Laufzeit. Zum Anderen durch das Institut der Aufrechnung (§§ 1438 ff ABGB;).
1. Das subjektive Erfordernis der "Kenntnis" wird von der Rsp ernst genommen (vgl 6 Ob 103/08b). Verlangt wird positive Kenntnis; objektive Erkennbarkeit genügt grundsätzlich nicht (stRsp; zuletzt ausdrücklich 1 Ob 15/08z). Unter bestimmten Voraussetzungen nimmt die Rsp zwar eine Erkundigungsobliegenheit an; dabei wird aber ein sehr restriktiver Maßstab angelegt und betont, dass die Anforderungen an die Eigensorgfalt des Geschädigten niedrig anzusetzen sind und die Erkundigungsobliegenheit keinesfalls überspannt werden darf (vgl 4 Ob 353/98k, wonach Medienberichte über die "Talfahrt der AG" nicht ausreichen).
Fristauslösend können neben Mitteilungen der Bank über mögliche Deckungslücken zwar grundsätzlich auch Kursschwankungen beim Tilgungsträger sein (vgl 7 Ob 253/97z; 9 Ob 17/07a); ebenso die Übersendung jährlicher Depotauszüge und Tätigkeitsberichte, aus denen derartige Kursschwankungen hervorgehen. Dabei kommt es aber entscheidend darauf an, ob der Verbraucher daraus notwendig schon auf das Vorliegen eines (realen) Schadens schließen muss.
Die Rsp ist hier jedenfalls bei einer Kombination aus FWK und Tilgungsträger mit Recht sehr zurückhaltend (6 Ob 103/08b): Ist den Verbrauchern nicht die Risikolosigkeit einzelner Anlageformen, sondern die Risikolosigkeit des Gesamtfinanzierungskonzepts zugesichert worden, beginnt die Verjährungsfrist erst dann zu laufen, wenn sie erkennen, dass das Gesamtkonzept nicht risikolos war.
2. Die bisher zu FWK ergangene Rsp dürfte die Kenntnis vom Eintritt des realen Schadens allein (= risikobehaftetes Finanzierungskonzept) - anders als bei Wertpapieren - nicht ausreichen lassen, sondern zusätzlich auf die Kenntnis abstellen, dass ein rechnerischer Schaden in der Zukunft sicher eintreten wird.
So wurde der Beginn der Verjährungsfrist erst dann bejaht, wenn sich der FWK "rein rechnerisch nicht mehr ohne zusätzliche Vermögensverminderung im Vergleich zur (herkömmlichen) Tilgung der Darlehen und Geldmittelbeschaffung vor dem Umschuldungs- und Finanzierungskonzept entwickeln konnte" (6 Ob 103/08b).
Endet die Laufzeit des Tilgungsträgers vor jener des Kreditvertrags (konkret: 5 Jahre) und wurde ursprünglich eine Verlängerungsmöglichkeit für den Fall in Aussicht gestellt, dass dessen bisherige Erträge zur Tilgung des Kredits nicht ausreichen, ließ die Rsp die Verjährungsfrist nicht schon dann beginnen, wenn die Verbraucher über die mögliche Tilgungsträgerlücke bei Ende der Kreditlaufzeit informiert wurden (dies entspräche der Kenntnis vom Eintritt eines realen Schadens), sondern erst, als sie erfuhren, dass eine Verlängerung des Tilgungsträgers nicht möglich ist (HG Wien 53 Cg 83/11v, rk). Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass die Kläger noch nicht sicher vom Eintritt eines rechnerischen Schadens zum Ende der Kreditlaufzeit ausgehen mussten, solange für sie die Möglichkeit bestand, dass der Tilgungsträger noch ausreichend steigen
könnte. Letzterer Aspekt wäre freilich für den Beginn der Verjährungsfrist völlig irrelevant, wollte man lediglich auf die Kenntnis vom realen Schaden abstellen und ist daher ein Indiz dafür, dass die Rsp die Kenntnis vom Eintritt des realen Schadens bei FWK nicht ausreichen lässt. Gesichert ist diese Schlussfolgerung aus derzeitiger Sicht aber freilich noch nicht.
Möglich erscheint darüber hinaus, dass die Rsp den Zeitpunkt der Kenntnis vom realen Schaden weiter fasst. Besonders zu berücksichtigen wäre vor allem der Aspekt der Endfälligkeit des FWK. Aus dieser resultiert nicht nur eine massive Erhöhung des Risikos des Verbrauchers, für den es hinsichlich der Kurswerte auf diesen einen Zeitpunkt in der Zukunft ankommt, sondern auch eine erhebliche Verschlechterung seiner Position durch Erhöhung der Kosten- und Zinsbelastung im Vergleich zu tilgenden FWK, weil diese stets vom gesamten - sich nicht verringernden - Kapital bemessen wird. Diesen Nachteilen des Verbrauchers stehen ausschließlich Vorteile auf Seiten der Bank entgegen. Damit liegt eine erhebliche Disparität der wechselseitigen Positionen von Bank und Verbraucher vor, aus der nach unserer Ansicht erhöhte Aufklärungspflichten resultieren. Für die Verjährung kann dieser Aspekt relevant werden, weil der Verbraucher von der Bank zwar häufig nachträglich über Währungs-, allenfalls auch Tilgungsträgerrisiken aufgeklärt wird, nie aber über die aus der Endfälligkeit resultierenden Gefahren und Nachteile, die aber freilich genauso zum Gesamtkonzept gehören. Insofern fehlt iaR auch die fristauslösende Kenntnis.
Beachte: Dass den aus der endfälligen Ausgestaltung resultierenden Nachteilen des Verbrauchers massiv erhöhte Risiken, höhere Zinsbelastung nur Vorteile der Bank gegenüber stehen, die aufgrund der iaR gegebenen Überbesicherung des Kredits (130-150 %) gefahrlos höhere Zinsgewinne lukriert, begründet eine massive Ungleichgewichtslage zwischen den Vertragsparteien, die diese Ausgestaltung möglicherweise auch im Lichte von § 879 Abs 1 bzw Abs 2 Z 4 ABGB (Sittenwidrigkeit, Wucher) bedenklich erscheinen lässt.
3. Nach unserer Ansicht kann man noch einen Schritt weiter gehen und für den Lauf der Verjährungsfrist weder den Eintritt des realen Schadens allein ausreichen lassen, noch die (zusätzliche) Kenntnis vom sicheren Eintritt eines rechnerischen Schadens in der Zukunft, sondern auf den Eintritt des rechnerischen Schadens abstellen. Die Verjährung könnte demnach frühestens zum Ende der Laufzeit beginnen. Dafür spricht in wertender Betrachtung, dass das zeitliche Auseinanderfallen des Eintritts von realem und rechnerischem Schaden bei laufzeitabhängigen Produkten wie FWK schon in der strukturellen Beschaffenheit des Produkts, damit zugleich in der strukturellen Beschaffenheit des Schadens bedingt ist und die Naturalrestitution für den Verbraucher oft untunlich sein wird; diese Komponente kann nun aber in keinster Weise der Sphäre des Geschädigten zugeordnet werden. Die dem Verjährungsrecht immanente Abwägung zwischen den Interessen von Schädiger und Geschädigtem schlägt daher wohl eher zugunsten des Letzteren aus. Eine Spekulationsgefahr zulasten des Schädigers besteht nicht, weil der Zeitpunkt des fristauslösenden Ereignisses von vornherein feststeht. Darin liegt zugleich ein entscheidender Unterschied zu den Fällen des Erwerbs nicht gewollter risikoträchtiger Wertpapiere, wo es auf den Verkauf der Wertpapiere ankommt, dessen Zeitpunkt im Belieben des Geschädigten steht.
4. Beschwichtigungsversuchen des Vermittlers oder der Bank - etwa über Nachfrage nach Übermittlung der Depotauszüge oder einschlägiger Medienberichte - kann in zweierlei Hinsicht Bedeutung zukommen (6 Ob 103/08b): Einerseits können sie verhindern, dass sich der Verdacht des Anlegers zur für den Beginn der Verjährungsfrist erforderlichen Gewissheit verdichtet; diesfalls zögern die Auskünfte des Beraters folglich schon den Beginn der Verjährungsfrist hinaus. Oder - nach bereits eingetretener Kenntnis - dem Verjährungseinwand kann im Prozess die Replik der Arglist (Treu und Glauben) entgegen gehalten werden.
5. Für den Beginn der Verjährungsfrist ist erforderlich, dass dem Geschädigten der anspruchsbegründende Sachverhalt so weit bekannt ist, dass eine Klage mit Aussicht auf Erfolg erhoben werden könnte (stRsp). Dies gilt nicht nur für die Kenntnis vom Schaden, sondern auch in Hinblick auf die Person des Ersatzpflichtigen. Beruht die Haftung der Bank auf einer Zurechnung fremden Verschuldens (= der fehlerhaften Beratung durch den Vemittlers) (dazu unten), muss dem Verbraucher daher nach unserer Auffassung auch der zurechnungsbegründende Sachverhalt (Vertriebsvereinbarung, Provisionen; 4 Ob 129/12t) bekannt sein. Davor kann die Verjährung seines Ersatzanspruchs gegen die Bank nicht beginnen. Rsp dazu liegt allerdings noch nicht vor - insofern ist Vorsicht geboten.
Beachte: Weiß zwar nicht der Verbraucher selbst über etwaige zurechnungsbegründende Umstände Bescheid, aber die vom Verbraucher mit der Prüfung und allenfalls auch Durchsetzung seiner Ansprüche betraute Verbraucherschutzorganisation bzw Rechtsanwaltskanzlei, ist in Hinblick auf die Verjährung Vorsicht geboten: Diese sind sog "Wissensvertreter", deren Wissen dem Verbraucher grundsätzlich zuzurechnen ist (vgl zum Zinsenstreit 9 Ob 23/07h; 1 Ob 241/07h; 8 Ob 98/09h).
Zur Wissenszurechnung kommt es allerdings nach bisheriger Jud nicht pauschal hinsichtlich aller für den Verbraucher potentiell rechtserheblicher Tatsachen; vielmehr ist diese beschränkt: Zugerechnet wird nicht jedes Wissen, sondern nur jenes, das sich auf den jeweiligen Gegenstand der konkreten Beauftragung bzw - bei Inkassozession - den jeweils abgetretenen Anspruch bezieht. Lautet die Anfrage des Verbrauchers aber pauschal auf die Prüfung aller in Betracht kommender Ansprüche, wird das Wissen um zurechnungsbegründende Umstände hinsichtlich möglicher weiterer Haftpflichtiger zugerechnet.
Die Wissenszurechnung erfolgt immer ex nunc und wirkt nicht zurück. Das Wissen der Verbraucherschutzorganisation kann also nicht dazu führen, dass der Verjährungsbeginn für den Verbraucher in die Vergangenheit vorverlagert wird. Die Beratung kann aber dazu führen, dass die Verjährungsfrist beginnt. Der Verbraucher sollte daher vorsichtshalber darauf hingewiesen werden, dass er für die Durchsetzung seiner Ansprüche ab jetzt noch drei Jahre Zeit hat.
6. Zur Entschärfung etwaiger Verjährungsprobleme kommt möglicherweise eine Aufrechnung des Schadenersatzanspruchs des Kreditnehmers gegen den Rückzahlungsanspruch der Bank in Betracht (§§ 1438 ff ABGB). Rsp dazu liegt allerdings noch nicht vor. Etwaig mit der Bank vereinbarte Aufrechnungsverbote wären jedenfalls unwirksam (§ 6 Abs 1 Z 8 KSchG). Dass der Schadenersatzanspruch des Verbrauchers bei Laufzeitende bereits verjährt ist, stünde der Aufrechnung nach stRsp jedenfalls nicht entgegen (6 Ob 1622, 1623/91; 7 Ob 64/01i); ausreichend ist aufgrund der Rückwirkung der Aufrechnung nämlich, dass sich die beiden Forderungen in der Vergangenheit aufrechenbar gegenüber gestanden sind. Ungeklärt ist aber, ob die Rsp das Erfordernis der wechselseitigen Fälligkeit der Ansprüche als erfüllt ansehen wird.
Beachte: Sind seit dem Zeitpunkt, wo dem Verbraucher - etwa durch Mitteilung der Bank über drohende Deckungslücken - bekannt wurde, dass es ein Problem geben könnte, mehr als drei Jahre vergangen, sollte nicht einfach weiter bis zum Laufzeitende abgewartet werden, weil ohnehin die Möglichkeit der Aufrechnung besteht. UU empfiehlt sich vor dem Hintergrund der aktuellen Jud auch jetzt noch die Einbringung einer Feststellungsklage, eventualiter das Begehren auf Leistung durch Naturalrestitution. Zumindestens sollte aber der Schadenersatzanspruch in einem Schreiben an die Bank fällig gestellt werden! Ob die Rsp die Möglichkeit zur Aufrechnung bejahen wird, ist derzeit noch offen.
D. Ersatzpflichtige
Schadenersatzansprüche des Verbrauchers können sowohl
(1) gegen den Anlageberater/-vermittler zustehen als auch
(2) gegen die - primär nicht beratende, sondern finanzierende - Bank oder
(3) - bei Versicherungsprodukten als Tilgungsträger - die Versicherung.
Wer konkret haftet, hängt primär davon ab, wen welche Beratungspflichten treffen (in Hinblick auf Gesamtprodukt, Währungsrisiko, TT-Risiko, Kombinationsrisiko) und wem die Fehlberatung durch den Vermögensberater zugerechnet werden kann. Klare Leitlinien dazu, ob und unter welchen Umständen die Bank und/oder die Versicherung bei der Vergabe von FWK in die Pflicht genommen werden kann, wurden von der Judikatur bis dato nicht entwickelt.
Beachte: Zur Abgrenzung der Verantwortungsbereiche von Bank, Versicherung und selbstständigem Vermögensberater und die Intensität der jeweiligen Aufklärungspflichten von Bank und Versicherung existiert noch keine gesicherte Judikatur. Daher ist Vorsicht geboten und zumindest außergerichtlich eine mögliche Haftung aller im Blick zu behalten.
In Hinblick auf die Verantwortung für Gesamtfinanzierungskonzept/Produktkombination: Wer hat diese vorgeschlagen bzw entworfen: der selbständige Berater / die Bank / die Versicherung? (Anm: Denjenigen treffen wohl iSe Ingerenzpflicht umfassende und ganz spezifische Aufklärungs- und Beratungspflichten hinsichtlich der besonderen Risiken)
Wer hat worüber aufgeklärt? Über das Fremdwährungsrisiko / das Tilgungsträgerrisiko / die Risikoverschärfung aus der Kombination. (Anm: Wichtig schon deshalb, weil auch das Wissen des Verbrauchers qua Aufklärung/Information durch andere Personen für die Ersatzansprüche gegen die potentiell Haftpflichtigen entweder schon die Rechtswidrigkeit entfallen lässt, oder aber und iaR die Kausalität)
In Hinblick auf die Zurechnungsfrage:
Ist der Vermögensberater als unabhängiger Makler aufgetreten oder als für eine bestimmte Versicherung / Bank tätiger Vermittler? (Anm: dann allenfalls bei zurechenbarem Rechtsschein: Zurechnung als Anscheinserfüllungsgehilfe analog § 1313a ABGB)
In wessen Interesse war der Vermögensberater/-vermittler konkret tätig (Vertriebsvereinbarung / über bloße Rahmenprovisionsvereinbarung hinausgehende Provisionen / produktspezifische Schulungen? [Anm: Zurechnung [analog] § 43, § 43a VersVG; bei "falschen" Schulungen allenfalls auch quasivertragliche Haftung gegenüber den betroffenen Verbrauchern qua Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter])
(1) Vermittler
Erfolgt die Beratung durch einen selbständigen Vermittler, treffen diesen umfassende Aufklärungs- und Beratungspflichten. Klagen gegen den Anlageberater waren bereits häufig Gegenstand der Rsp und iaR - Kausalität und Rechtswidrigkeit vorausgesetzt - auch erfolgreich.
Dabei kann vor allem die (Berufs)Haftpflichtver-sicherung des Vermittlers interessant sein: In der Insolvenz des Versicherungsnehmers (Vermittlers) steht dem Verbraucher ein Absonderungsrecht an der Entschädigungssumme zu (§ 157 VersVG). Reicht die Versicherungssumme zur Befriedigung mehrerer Geschädigter nicht aus (was bei einer Mindestsumme von ca 1,5 Mio ? jedenfalls bei systematischen Fehlberatungen häufig der Fall sein dürfte), findet ein sog Deckungskonkurs statt, der zur anteiligen Befriedigung aller führt (§ 156 Abs 3 VersVG).
Beachte: Um den Deckungsschutz durch die Haftpflichtversicherung des Beraters/Vermittlers nicht zu riskieren, sollte der Verbraucher dieser den Eintritt des Versicherungsfalls unverzüglich schriftlich melden (§ 158d VersVG: bei außergerichtlicher Geltendmachung innerhalb von zwei Wochen, bei gerichtlicher Geltendmachung sofort). Die Verletzung der Anzeigeobliegenheit kann zur Kürzung des Anspruchs (§ 158e VersVG), in Hinblick auf etwaig im Einzelfall nach Vertragsbeendigung vereinbarte - uE unzulässige - Nachhaftungsbegrenzungen sogar zum Verlust der Deckung führen (zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes: Verstoßprinzip).
Informationen über die Versicherung des Beraters und somit darüber, wem der Verbraucher den Schadensfall anzeigen muss, lassen sich über einen Gewerberegisterauszug ermitteln.
(2) Bank
Ein attraktiver Schuldner ist für den Verbraucher aufgrund des iaR größeren Haftungsfonds auch die Bank. Deren Haftung wurde von der Judikatur zwar ursprünglich eher restriktiv behandelt. Aktuelle Entscheidungen des OGH nehmen die Banken allerdings vermehrt in die Pflicht. Ihre Haftung kann sich entweder aus eigenen (vor-)vertraglichen Aufklärungs- und Beratungspflichtverletzungen ergeben oder aber - bei Einschaltung selbständiger Vermittler durch den Verbraucher - aus einer Zurechnung der Fehlberatung des (externen) Anlageberaters/-vermittlers.
1. Übernimmt die Bank die Vermögensberatung des Verbrauchers, treffen sie umfassende Aufklärungs- und Beratungspflichten, die sich auf die Konstruktion des gesamten Finanzierungskonzepts beziehen (dh anleger- und objektgerechte Beratung, die eine Aufklärung über alle - auch die mit dem Tilgungsträger verbundenen - Risiken beinhaltet). Dasselbe gilt nach der Rsp, wenn die Bank ihre "Finanziererrolle" überschreitet.
Nach unserer Auffassung ist dies schon dann der Fall, wenn die Bank das Finanzierungskonzept "im Paket" anbietet bzw empfiehlt. Auch der ersatzfähige Schaden umfasst in diesen Fällen alle vertraglichen Elemente, die mit der Aufnahme des FWK einhergehen (daher insb auch den Tilgungsträger), sodass sich bei der Schadensberechnung kein Problem des Rechtswidrigkeitszusammenhangs stellt, sondern nur die Kausalität der Fehlberatung auch in Hinblick auf den Erwerb des Tilgungsträgers zu prüfen ist (dazu oben).
Beachte: In diesen Fällen hat die Bank nicht nur für die Fehlberatung durch ihre Mitarbeiter einzustehen (§ 1313a ABGB), sondern uU auch für die Fehlberatung durch Personen, die nur den Eindruck erwecken, Mitarbeiter der Bank zu sein (Zurechenbarkeit sog "Anscheinserfüllungsgehilfen" analog § 1313a ABGB). Voraussetzung dafür ist nach allgemeinen Grundsätzen der Rechtsscheinhaftung ein der Bank zurechenbarer Rechtsschein, auf den der Verbraucher konkret auch vertraut und vertrauen darf (Redlichkeitserfordernis).
Vgl zuletzt den Fall vom HG Wien 53 Cg 83/11v : Berater war zwar für die Tochtergesellschaft der Bank ("Bank Austria Finanzservice") tätig, führte die Beratung aber in der Filiale der beklagten Bank mitsamt Arbeitsplatz und Computerausstattung vor Ort durch und druckte den Finanzierungsvorschlag auf deren Briefpapier aus. Selbst eine entsprechende Offenlegung durch den Berater (ob dieser der Kl seine Visitenkarte übergeben hatte, konnte nicht mehr festgestellt werden) könnte nach dem HG Wien die Zurechnung im konkreten Fall nicht verhindern, weil eine solche noch nicht notwendig auf eine eigenständige Gesellschaft schließen lasse, sondern es sich ebenso gut nur um eine interne Abteilung der bekl Bank handeln könne.
2. Ansonsten wurden Aufklärungspflichten der Bank über das Tilgungsträgerrisiko in der Rsp bislang verneint (OLG Wien 4 R 166/10a; 2 Ob 259/08i), und zwar unter Verweis auf jene Judikaturlinie, wonach bei der Finanzierung risikoträchtiger Beteiligungen ein Einwendungsdurchgriff auch bei wirtschaftlicher Einheit von finanziertem Geschäft und Kreditvertrag nicht in Betracht komme und die finanzierende Bank - solange sie ihre Rolle als Finanzierer nicht überschreitet - nur bei Kenntnis atypischer Risiken eigene Aufklärungspflichten treffen (krit dazu Graf, ecolex 1990, 8 ff; ders, ecolex 1991, 599 ff).
Beachte: Auch in diesen Fällen ist aber unserer Ansicht nach - nur, aber immerhin - über das Fremdwährungsrisiko aufzuklären. Ist die Verletzung dieser Aufklärungspflicht kausal für den Finanzierungs- bzw Veranlagungsentschluss des Verbrauchers, haftet die Bank. Bei der Schadensberechnung stellt sich freilich in Hinblick auf das - nicht vom Schutzzweck der Aufklärungspflicht erfasste - Tilgungsträgerrisiko hier die - in der Rsp bislang ungeklärte - Frage, wie sich der insofern fehlende Rechtswidrigkeitszusammenhang bei der Abwicklung der Vertragsverhältnisse niederschlägt. Dazu oben.
Nach unserer Ansicht bestehen darüber hinaus stets dann erhöhte Aufklärungspflichten der Bank in Hinblick auf das gesamte Finanzierungskonzept, wenn der Bank erkennbar ist, dass der selbständige Berater des Verbrauchers keine Konzession zur Vermögensberatung hat oder nicht die Interessen des Kunden wahrt. Rsp dazu liegt aber noch nicht vor.
3. Bejaht wurde von der Rsp die Aufklärungspflicht der Bank über das erhöhte Risiko, das aus der Kombination von Fremdwährungskredit und Tilgungsträger resultiert. Konkret wurde die Haftung auf die Verletzung vorvertraglicher Schutzpflichten gestützt (LGZ Wien 24 Cg 69/09g, rk): Die Bank hatte zwar über das Währungsrisiko beim FWK aufgeklärt, nicht aber über die besondere Risikoverschärfung, die sich aus der Kombination von Tilgungsträger und FWK ergibt; sie wusste über die Unerfahrenheit des Klägers, die Gestaltung des - äußerst riskanten - Modells (Tilgungsträger in Dollar, FWK in Yen, unterschiedliche Laufzeiten) Bescheid und ihr mussten die Schwierigkeiten des Kunden zur Auffüllung der Deckungslücke bei Verwirklichung der Risiken bewusst sein.
4. Für die Zurechnung fremder Fehlberatung hat der OGH in der Vergangenheit teilweise auf das Kriterium der Verwendung der Formulare einer Bank (Überlassung von Depoteröffnungsanträgen, Werbebroschüren) abgestellt (4 Ob 586/95; 6 Ob 24/10p; 3 Ob 283/06y) und damit auf jener Judikatur aufgebaut, wonach der Anbieter einer drittfinanzierten Anlage der finanzierenden Bank als Verhandlungsgehilfe zugerechnet wird, wenn sie diesen mit den entsprechenden Formularen ausstattet.
In vereinzelten Entscheidungen unterinstanzlicher Gerichte wurde die Zurechnung des externen Vermittlers/Beraters an die finanzierende Bank dagegen fallweise mit der Begründung verneint, die Bank erlange erst nach dem Beratungsgespräch zwischen Anleger und Finanzberater Kenntnis vom Interesse des Anlegers, sodass zweifelhaft sei, ob eine zurechnungsbegründende "Veranlassung" oder "Beauftragung" des vorgeschaltenen WPDU überhaupt denkbar ist (OLG Wien 5 R 262/10a; 5 R 295/11f).
In einer aktuellen Entscheidung des OGH wurde die Zurechnung fehlerhafter Beratung durch externe Vermögensberater stark ausgeweitet (4 Ob 129/12t: Zurechnung des AWD zur ehemaligen Constantia Privatbank). Der OGH wendet die versicherungsrechtlichen Zurechnungsregeln (§§ 43 ff VersVG) sinngemäß an; danach haftet die Versicherung für das Verschulden ihrer Versicherungsagenten, also von Personen, die von der Versicherung ständig betraut sind, Versicherungsverträge zu vermitteln. Das hier bestehende wirtschaftliche Naheverhältnis lässt es nämlich zweifelhaft erscheinen, ob der Agent in der Lage ist, die Interessen des Kunden ausreichend zu wahren. Wird daher ein Vermögensberater von einer Bank oder Versicherung ständig mit der Vermittlung von bestimmten Anlageprodukten betraut (Vertriebsvereinbarung!), so entsteht dadurch auch ein wirtschaftliches Naheverhältnis, das es rechtfertigt, ein Verschulden des Beraters nach § 1313a ABGB der Bank zuzurechnen. Schließlich nimmt die Bank die Vorteile der Auslagerung des Vertriebes und damit einer Arbeitsteilung in Anspruch und soll daher für Fehler des Beraters einstehen. Zu den Auswirkungen der E auf die Verjährungsfrage oben.
Eine weitere rezente E des OGH (8 Ob 104/12w) stützt die Haftung der ehemaligen CPB auf die Schutzgesetzeigenschaft des börsegesetzlichen Kursmanipulationstatbestands (§ 48a Abs 1 Z 2 lit c BörseG). Anleger dürfen danach nicht mit falschen Versprechungen bzw mit unvollständigen oder unrichtigen Informationen zum Erwerb von Aktien, zu deren Verkauf oder auch zu deren Halten bewogen werden. War der Bank erkennbar, dass die von ihr im Vertriebsweg gestreuten - und damit gerade zur Weiterleitung an die Kunden bereit gestellten - Informationen irreführend oder unrichtig sind, haftet sie nach dem OGH "jedenfalls" den Kunden gegenüber, die über diesen Vertriebsweg betreut werden.
Beachte: Die E hat vor allem große Bedeutung für die Haftung des Emittenten bzw der Gesellschaft; nicht nur, aber zB wenn Immofinanz-Aktien als Tilgungsträger dienten.
(3) Versicherung
Schadenersatzansprüche können auch gegen die Versicherung bestehen, mit der eine fondsgebundene Lebensversicherung als Tilgungsträger abgeschlossen wurde. Diese treffen gem § 75 Abs 2 und 3 VAG eigene Aufklärungspflichten bei index- oder fondsgebundenen Lebensversicherungen über das Versicherungsprodukt, die nach Auffassung der üLehre grundsätzlich auch nicht auf externe Vermittler ausgelagert werden können.
Erhöhte Aufklärungspflichten über das Gesamtfinanzierungskonzept, vor allem über die besondere Risikoverschärfung, die sich aus der Kombination mit dem Fremdwährungskredit ergibt, treffen die Versicherung nach unserer Ansicht - komplementär zur Pflichtenverschärfung auf Seiten der Bank -, wenn sie das Finanzierungsprodukt empfiehlt bzw entwirft.
Darüber hinaus kann sich die Haftung der Versicherung aus einer Zurechnung fremden Verschuldens ergeben. Die Zurechnung von Versicherungsvermittlern wird in §§ 43 ff VersVG geregelt:
1. Umfassend zugerechnet wird der Versicherung das Verhalten ihrer Versicherungsagenten iSd § 43 Abs 1 S 1 VersVG (§ 1313a ABGB). Versicherungsagent ist, wer von einem Versicherer ständig damit betraut ist, für diesen Versicherungsverträge zu vermitteln oder zu schließen (Dauerschuldverhältnis, aus dem sich eine Verpflichtung des Vermittlers zur Ausübung seiner Vermittlungstätigkeit ergibt).
2. Zugerechnet wird ein Vermittler auch, wenn er zum Versicherer in einem solchen wirtschaftlichen Naheverhältnis steht, das es zweifelhaft erscheinen lässt, ob er in der Lage ist, überwiegend die Interessen des Versicherungsnehmers zu wahren (sog Pseudomakler, § 43a Vers VG). Da ein Fall der Haftung für fremdes Verhalten vorliegt, gilt dies nach hA aber nur dann, wenn der Versicherer von der wirtschaftlichen Abhängigkeit des Maklers weiß oder zumindest wissen muss.
Beachte: Da der Pseudomakler echter Makler ist, kommen im Übrigen nicht die Bestimmungen über Versicherungsagenten (§§ 43 bis 48 VersVG) zur Anwendung, sondern jene über Versicherungsmakler. Dementsprechend haftet der Pseudomakler auch selbst für Pflichtverletzungen gegenüber dem Kunden, sodass es zu einer für den Kunden günstigen Solidarhaftung von Makler und Versicherer kommen kann.
3. Gem § 43 Abs 1 S 2 Fall 1 VersVG gelten die für Versicherungsagenten einschlägigen Bestimmungen des VersVG auch für denjenigen, der auch nur im Einzelfall vom Versicherer betraut ist. Der sog Gelegenheitsvermittler wird üblicherweise zur Vermittlungstätigkeit ermächtigt, aber nicht verpflichtet. Vertritt er nun entsprechend der Vereinbarung primär die Interessen des Versicherers, gilt er als Versicherungsagent.
Beachte: Anders als der Anscheinsagent, der aufgrund eines vom Versicherer gesetzten "äußeren Tatbestands" selbst und gerade dann, wenn es an einer Ermächtigung oder gar Betrauung fehlt, als Agent gilt (vgl § 43 Abs 1 S 2 Fall 2 VersVG), gilt der Vermittler kraft "inneren Tatbestands" als Agent: Die Ermächtigung, als "Gehilfe des Versicherers" tätig zu werden, reicht zur Anwendung der für Versicherungsagenten geltenden Bestimmungen und damit zur Zurechnung gem § 1313a ABGB aus, wenn der Vermittler im Einzelfall tatsächlich als "Gehilfe des Versicherers" tätig wird.
E. Mitverschulden
Ein Mitverschulden des Anlegers kann seinen Ersatzanspruch mindern (§ 1304 ABGB). Als solches wurde in der bisherigen Rsp gewertet, wenn der Kunde Informationsmaterial nicht beachtet oder Risikohinweise nicht liest; ebenso, wenn er irreal hohe Gewinnversprechen nicht hinterfragt (zuletzt etwa 5 Ob 246/11d).
Grundsätzlich kein Mitverschulden begründet nach der Judikatur die Nichtannahme von Vergleichsangeboten Dritter (2 Ob 238/12g).
Beachte: Zumindest prima vista könnte eine Verletzung von Schadenminderungsobliegenheiten auch darin liegen, dass der Verbraucher etwaigen schadensmindernden Angeboten der Bank - etwa auf Konvertierung des Kredits - nicht zustimmt.
Dass sich - aus der Perspektive ex post - die Deckungslücke vergrößert bzw der Kredit weiter vertreuert hat, reicht allerdings nicht aus. Nachdem niemand zukünftige Kursentwicklungen des Tilgungsträgers vorhersehen kann, kommt eine Berücksichtigung als Mitverschulden nach unserer Ansicht vielmehr nur dann in Betracht, wenn das Verhalten des Verbrauchers aus einer ex ante-Perspektive von der Bandbreite an möglichen hypothetisch angeratenen Vorgangsweisen eklatant abweicht und sich darüber hinaus auch tatsächlich schadensvergrößernd niedergeschlagen hat (Kausalität). Zudem muss der Verbraucher den Ratschlägen jener Bank, die ihn bereits einmal nicht oder fehlerhaft beraten hat, wohl grundsätzlich nicht Folge leisten (Leupold/Ramharter, ÖBA 2010, 718 [732 f]).
In Bezug auf die Mitverschuldensanteile differenziert die Rsp danach, ob der Kunde Verbraucher oder wirtschaftserfahrener Unternehmer ist. In letzterem Fall wurde gleichteiliges Mitverschulden angenommen (Schadensteilung): bei gänzlich fehlender Überprüfung der übergebenen Unterlagen, aus denen mögliche Finanzierungslücken sowie Risiken hervorgegangen wären und blindem Vertrauen auf Zusicherungen des Anlageberaters, wonach das empfohlene Finanzierungsmodell, das ohne oder bloß mit geringfügiger Eigenleistung eine garantierte Rente in nicht unbeträchtlicher Höhe sichern sollte, eine risikoarme Anlage sei (3 Ob 49/12w).
Bei Unerfahrenheit der Kunden in Finanzangelegenheiten wurde in der bisherigen Rsp ein Mitverschulden von einem Drittel angerechnet (HG Wien 53 Cg 83/11v); ebenso in einem Fall, in dem die Kundin (Mindestrentnerin, die ihr Vermögen anlegen wollte; Empfehlung des Beraters zum Erwerb der Wertpapiere im Ausmaß von ca 40.000 unter Zusage eines 11%igen Ertrags bei Sicherheit der Investition und Finanzierung des Ankaufs über FWK) bereits Wertpapiergeschäfte abgewickelt hatte, die in den Informationsblättern und am Formular abgedruckten Risikohinweise aber nicht las (8 Ob 9/10x, KRES 9/124).
III. Unzulässige Klauseln
A. Einführung
Abwertung des Euro und Wertverfall des Tilgungsträgers führen - verstärkt durch die Finanzkrise - vermehrt zu nachträglichen Anpassungen des Kreditvertrags: Konvertierungen, Zinsaufschläge (Liquiditätsaufschläge und Erhöhung der Refinanzierungskosten), Sondertilgungen bzw eine Aufstockung des Tilgungsträgers sowie Nachbesicherungen. Der VKI hat hier bereits zahlreiche Verbandsklagen geführt und gewonnen; dabei handelt es sich neben einigen höchstgerichtlichen Entscheidungen in vielen Fällen - weil die Banken bei klagestattgebenden Entscheidungen der Instanzen von der Erhebung weiterer Rechtsmittel zum OGH jeweils abgesehen haben - um rechtskräftige zweitinstanzliche Entscheidungen.
Wirksam sind derartige Vertragsänderungen von vornherein nur in zwei Fällen:
1. Wenn der Bank nach dem Vertrag ein - zulässiges! - einseitiges Änderungsrecht zusteht. Derartige Änderungsklauseln sind am Maßstab der §§ 864a ABGB (Geltungskontrolle), 879 Abs 3 ABGB (Inhaltskontrolle) und § 6 Abs 1, 2 und 3 KSchG auf ihre Zulässigkeit zu prüfen.
2. Wenn sie einvernehmlich erfolgen, dh mit Zustimmung des Verbrauchers. Auch die nachträgliche Vertragsänderung unterliegt freilich dem Kontrollmaßstab des § 6 Abs 2 KSchG, sofern die Vereinbarung nicht im Einzelnen ausgehandelt wurde (vgl zuletzt etwa 2 Ob 22/12t), und der Inhaltskontrolle gem § 879 Abs 3 ABGB.
Beachte: Die Vertragsänderung stellt iaR keine Novation dar, sondern ist bloße Schuldänderung (§ 1379 ABGB, vgl auch 8 Ob 31/05z [Verlängerung und Umwandlung in FWK]; wichtig für den Fortbestand etwaiger Sicherungsrechte).
Zu achten ist hier vor allem auf unzulässige Strategien der Bank zur Erlangung der Zustimmung. Typisch sind die folgenden zwei Ausprägungen:
- Die Bank übt Druck auf den Verbraucher aus, damit dieser der Vertragsänderung ausdrücklich zustimmt.
Beachte: Bei Arglist oder Drohung der Bank mit Zwangskonvertierung oder Fälligstellung kann der Verbraucher die Vertragsänderung anfechten (§ 870 ABGB); bei Arglist innerhalb von 30 Jahren, bei Drohung innerhalb von drei Jahren "ab Wegfall der Zwangslage" (§ 1487 ABGB).
Wird die Drohung mit Fälligstelung/Zwangskonver-tierung mit einer entsprechenden AGB-Klausel untermauert, kann sich der Verbraucher dagegen einerseits individuell wehren, indem er sich darauf beruft, durch die Klausel arglistig in die Irre geführt worden zu sein. Oder der VKI kann kollektiv mit Verbandsklage gegen die unzulässige Klausel vorgehen.
Beispiel: Die Volksbank behält sich mit einer Klausel vor, die Konditionen für Kreditverträge bei Änderung bestimmter für die Zinssatzfestlegung maßgeblicher Umstände neu zu verhandeln und für den Fall, dass keine Einigung zustande kommt, den Kreditvertrag zu kündigen. (Anm: Auf die Abmahnung des VKI hin hat die Bank eine vertragsstrafenbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben). Eine ähnliche Klausel ist nach dem OLG Innsbruck (3 R 183/11b, rk) unzulässig, weil sie der Bank ein Rücktrittsrecht auch ohne wichtigen Grund einräumt (in concreto auch versteckt unter "Sonstige Vereinbarungen": § 864a ABGB).
Beispiel: Die Klausel, wonach "Das Kreditverhältnis [..] unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Ende einer Zins- bzw Abschlussperiode schriftlich von beiden Seiten gekündigt werden [kann]" verstößt gegen § 6 Abs 2 Z 1 KSchG (Rücktrittsvorbehalt) und § 879 Abs 3 ABGB (keine Voraussetzungen für die Ausübung des ordentlichen Kündigungsrechts durch die Bank vorgesehen, daher wäre nach der Klausel auch Kündigung zur Unzeit möglich; OLG Graz 3 R 183/09w, rk).
Verstoß gegen § 6 Abs 2 Z 1 KSchG und § 879 Abs 3 ABGB auch dann, wenn die der Bank eingeräumte Kündigungsmöglichkeit "aus wichtigem Grund" nicht auf eine Gefährdung für die Bank abstellt (6 Ob 24/11i).
Beispiel: Für Altverträge vor Inkrafttreten des DaKRÄG (vgl nunmehr § 16 VKrG): Klausel, wonach bei vorzeitiger Rückzahlung durch den Kreditnehmer, "zu der er vertraglich (zB mangels Kündigungsvereinbarung oder infolge deren Nichteinhaltung) nicht berechtigt ist", die Bank ihre Zustimmung "von der Entrichtung einer von ihr bestimmten Vorfälligkeitsentschädigung in der Höhe von mindestens 5 % vom Rückzahlungsbetrag abhängig machen [kann]": Unzulässig nach § 879 Abs 3 ABGB, § 6 Abs 1 Z 5 KSchG (Entgeltänderung; die Bank kann de facto ein höheres Entgelt verlangen als bei vereinbarter Laufzeit) und § 6 Abs 3 KSchG (Berechnung und maximale Höhe unklar; OLG Innsbruck 3 R 183/11b, rk - VKI/Volksbank Tirol Innsbruck-Schwaz).
Erfolgt die Unterzeichnung der Vertragsänderung über vorherige Aufforderung durch die Bank in deren Filiale, kann der Verbraucher nach unserer Ansicht (analog) § 3 Abs 2 KSchG - bei fehlender Belehrung über die Widerrufsmöglichkeit durch die Bank: unbefristet (§ 3 Abs 1 KSchG) - zurücktreten. Achtung: Erforderlich ist eine schriftliche Rücktrittserklärung (§ 3 Abs 4 KSchG).
- Die Bank beruft sich unter Verweis auf entsprechende Erklärungsfiktionsklauseln auf die schlüssige Zustimmung durch den Verbraucher, wenn dieser der Vertragsänderung nicht innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht.
Beachte: Diese Vorgangsweise ist unserer Ansicht nach unzulässig. Der VKI führt aktuell ein Verfahren dazu und hat in zweiter Instanz Recht bekommen (OLG Graz 3 R 85/12p): Danach ist die Klausel gröblich benachteiligend (§ 879 Abs 3 ABGB); die Widerspruchsmöglichkeit kann das grobe Missverhältnis zwischen den Interessen nicht ausgleichen, zumal der Verbraucher von sich aus nachforschen muss, wie sich die Änderung des Zinssatzes auf seinen Vertrag auswirkt. Sie verstößt auch gegen § 6 Abs 1 Z 2 KSchG und § 6 Abs 3 KSchG. Die Entscheidung des OGH ist noch ausständig.
B. Konvertierung
Die AGB der Banken sehen häufig bestimmte Schwellen oder andere Umstände vor, bei deren Überschreiten die Bank (einseitig) zur Konvertierung in Euro befugt ist oder eine solche Konvertierung automatisch erfolgt (sog stop-loss-Klauseln).
Zulässig sind diese nur, wenn sie
1. die Umstände die zu einer Konvertierung durch die Bank führen (können), genau beschreiben.
Beispiele: Unzulässig ist die einseitige Konvertierungsbefugnis der Bank demnach bei "nachhaltigem Steigen der Wechselkurse bzw anderen nicht im Einflussbereich der Bank stehenden Faktoren, aufgrund derer sich eine Refinanzierung als unmöglich erweist" (OLG Graz 3 R 183/09w, rk: Verstoß gegen § 879 Abs 3 ABGB, § 6 Abs 3 KSchG, § 6 Abs 2 Z 3 KSchG); ebenso "Bei Eintritt von Umständen, welche die Kosten für die Bereitstellung, Aufrechterhaltung oder Refinanzierung des Kredits erhöhen" (OLG Graz 3 R 183/09w, rk; HG Wien 22 Cg 11/10a, rk: Verstoß gegen § 6 Abs 1 Z 5 KSchG, § 6 Abs 2 Z 3 KSchG, § 6 Abs 2 Z 4 KSchG, § 6 Abs 3 KSchG).
In Hinblick auf Sicherungsgeber unzulässig ist die Klausel "Die Sicherungsgeber erklären ferner, allfälligen Konvertierungen in eine andere Fremdwährung, oder EUR - aus welchem Grund immer diese erfolgen - unter Verzicht auf eine gesonderte Verständigung vorweg zuzustimmen." (§ 879 Abs 3 ABGB und § 6 Abs 1 Z 9 KSchG, OLG Graz 3 R 183/09w, rk).
2. und die Konvertierungsbefugnis von einer konkreten Erfüllungsgefährdung für die Bank abhängig machen (8 Ob 49/12g; 2 Ob 22/12t).
Beispiel: 8 Ob 49/12g (Verbandsprozess): "Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländische Währung umzuwandeln, wenn sich durch die Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht und das KI innerhalb angemessener Frist keine ausreichende Sicherstellung erlangt": Verstoß gegen § 6 Abs 3 KSchG ("ausreichende Sicherstellung", "angemessene Frist", fehlende Wechselkursgrenzen), § 879 Abs 3 ABGB. 2 Ob 22/12t (Individualprozess): Stop-loss-Klausel mit automatischer Konvertierung bei 15 %: Verstoß gegen § 6 Abs 2 Z 3 KSchG
Beachte: Wird der FWK aufgrund einer unzulässigen Klausel in Euro konvertiert, richtet sich der Schadenersatzanspruch des Verbrauchers einerseits auf Ersatz etwaiger Konvertierungsgebühren und Vorfälligkeitskosten sowie die Zinsdifferenz für die Vergangenheit, zum Anderen auf Rückkonvertierung in die Fremdwährung (Naturalrestitution).
Die Naturalrestitution kann auch während der Laufzeit mit Leistungsklage geltend gemacht werden. Die Zulässigkeit der Feststellungsklage hinsichtlich des allenfalls bei Laufzeitende eintretenden rechnerischen Schadens hat der OGH dagegen infolge Subsidiarität zur schon möglichen Leistungsklage verneint (fehlendes rechtliches Interesse, § 228 ZPO).
C. Liquiditätsaufschlag - Refinanzierung
Die AGB der Banken sehen häufig Klauseln vor, die zur Überwälzung geänderter Refinanzierungskosten führen sollen. Rechnung getragen wird höheren Refinanzierungskosten meist entweder durch eine Erhöhung des Zinsaufschlags (Marge) und/oder durch eine Änderung des Indikators.
Unzulässig sind derartige Klauseln insb, wenn sie bei Vorliegen der vereinbarten Voraussetzungen für eine Entgeltänderung nicht auch eine Senkung des Zinssatzes vorsehen (§ 6 Abs 1 Z 5 KSchG, § 879 Abs 3 ABGB [idS 10 Ob 145/05d]). Erforderlich ist auch, dass die für die Entgeltänderung maßgebenden Umstände im Vertrag - nach stRsp klar (sog "kleines Transparenzgebot") und nicht nur beispielhaft, sondern vollständig und abschließend - umschrieben und sachlich gerechtfertigt sind sowie ihr Eintritt nicht vom Willen des Unternehmers abhängt (§ 6 Abs 1 Z 5 KSchG; nach hA Unterscheidung zwischen innerbetrieblichen Maßnahmen und außerbetrieblichen Ereignissen wie idR auch durchschnittliche Marktentwicklungen, zum Meinungsstand mwN Eccher in Klang3 § 6 Abs 1 Z 5 KSchG Rz 5 f).
Beachte: Die Verwendung unzulässiger Klauseln kann nach stRsp Schadenersatzansprüche des Kunden begründen! Für die Verjährung zu viel bezahlter Margen gilt die - insofern verbraucherfreundliche - Zinsenstreit-Judikatur: Eintritt des Schadens und Beginn der (dreijährigen) Verjährungsfrist erst ab Überzahlung. Zu viel bezahlte Zinsen können - innerhalb von drei Jahren ab Überzahlung - auch bereicherungsrechtlich zurückgefordert werden (§ 1431 ABGB).
D. Sondertilgungen/Aufstockung/Wechsel des Tilgungsträgers/Nachbesicherung
Viele Klauseln geben der Bank das Recht, Sondertilgungen, Zuzahlungen zu Tilgungsträgern, einen Wechsel des Tilgungsträgers oder die Beistellung zusätzlicher Sicherheiten zu verlangen, häufig unter Androhung der sonstigen Fälligstellung/Zwangskonvertierung (dazu oben).
Klauselbeispiel: "Übersteigt der zum Mittelkurs aus An- und Verkaufskurs laut unserem Aushang entsprechend dem Erste Bank Devisenfixing umgerechnete Euro-Gegenwert des aushaftenden Finanzierungsbetrages den ursprünglichen Euro-Gegenwert bzw den laut Tilgungsplan unter Berücksichtigung der Rückführung entsprechend reduzierten (fiktiven) Euro-Betrag um mehr als 10 %, so verpflichten Sie sich, über unsere Aufforderung binnen 14 Tagen geeignete Sicherheiten zu bestellen oder die Finanzierung entsprechend rückzuführen."
Die Klausel ist jedenfalls unzulässig, wenn sie nicht im Einzelnen ausgehandelt wurde (§ 6 Abs 2 Z 1 KSchG, Rücktrittsvorbehalt; LG Feldkirch 38 Cg 172/08d, rk): Der Bank kommt ohne sachliche Rechtfertigung ein Recht auf nachträgliche Einforderung zusätzlicher Sicherheiten oder auf Rückführung des Kredits zu, was einem Vertragsrücktritt gleichkommt. Das Risiko einer negativen Währungsentwicklung ist aber jedem FWK immanent; daher sind beide Seiten gehalten, für eine ausreichende Besicherung des Kredits zu sorgen. Werden dem Kreditnehmer bei nachteiliger Währungsentwicklung über einen bestimmten Schwellenwert hinaus weitere Sicherheiten oder Teilabdeckungen abverlangt, ist damit aber eine ungerechtfertigte zusätzliche Leistung des KN verbunden.
Klauselbeispiel: Berechtigung der Bank, bei "nach Beurteilung der Bank eintretenden Beeinträchtigungen der Werthaltigkeit des Besicherungsobjekts (zB durch nicht ausreichenden Ankauf oder mangelhafte Performance der Fondsanteile), vom Kunden die Wiederherstellung der Werthaltigkeit oder andere Sicherheiten zu verlangen oder den Kredit fälligzustellen".
Unzulässige Klausel (OLG Innsbruck 3 R 183/11b, rk - VKI/Volksbank Tirol Innsbruck-Schwaz):
1) § 864a ABGB: nachteilige und ungewöhnliche Klausel, mit der der Kunde nach den Umständen nicht rechnen musste [abgedruckt nicht unter dem Punkt Sicherheiten, sondern auf der Folgeseite inmitten eines Textes, der Wesen und Risiken von Fondsanteilen darstellt].
2) § 879 Abs 3 ABGB: Abweichung vom dispositiven Recht (§ 458 ABGB: Recht auf Einräumung einer Ersatzsicherheit nur bei Verschlechterung der Pfandsache aus Verschulden des Pfandschuldners und bei schon ursprünglicher Unterdeckung) ist sachlich nicht gerechtfertigt. Sie enthält keine dem dispositiven Recht entsprechende Einschränkung, wonach ein Recht auf vorzeitige Verwertung des Pfandobjekts oder Bestellung einer Ersatzsicherheit nur dann besteht, wenn mit der Veränderung des Werts der Pfandsache die Gefahr einer (zumindest teilweisen) Uneinbringlichkeit der Forderung einhergeht. Solange eine Überbesicherung gegeben ist, fehlt die Erfüllungsgefährdung der Bank.
3) § 6 Abs 3 KSchG: "Werthaltigkeit des Besicherungsobjekts" intransparent
Klauselbeispiel: Z 47 ABB: "Das KI kann vom Kunden für alle Ansprüche aus der mit ihm bestehenden Geschäftsverbindung die Bestellung angemessener Sicherheiten innerhalb angemessener Frist verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt, befristet oder noch nicht fällig sind.")
Z 48 ABB ("(1) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen, ist das KI berechtigt, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten innerhalb angemessener Frist zu verlangen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben oder zu verändern drohen oder die vorhandenen Sicherheiten sich wertmäßig verschlechtert haben oder zu verschlechtern drohen. (2) Dies gilt auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Bestellung von Sicherheiten nicht verlangt wurde."
8 Ob 49/12g (Verbandsklage): jeweils Verstoß gegen § 6 Abs 3 KSchG
Beachte: Nach neuester Judikatur des EuGH (C-618/10) und des OGH (2 Ob 22/12t) scheidet eine geltungserhaltende Reduktion der inkriminierten Klausel sowie eine ergänzende Vertragsauslegung zulasten des Verbrauchers auch im Individualprozess aus; das gilt insbesondere und vor allem in Fällen, wo die Nachbesicherungsklausel gegen das Transparenzgebot gem § 6 Abs 3 KSchG verstößt (so zu Z 47 ABB 8 Ob 49/12g).
Diese Jud führt unserer Ansicht nach dazu, dass eine neu vereinbarte AGB-Nachbesicherungsklausel, auch wenn sie nunmehr transparent und auch inhaltlich an sich unbedenklich wäre, nur zulässig ist, wenn sie den Wert der jetzigen, aktuellen Besicherung zum Ausgangspunkt nimmt (Einfrieren des aktuellen Sicherungsniveaus). Grund ist: "Für die Vergangenheit" gilt aufgrund des Verbots der geltungserhaltenden Reduktion zwingend das dispositive Recht. Danach kann eine Nachbesicherung analog § 458 ABGB aber nur in zwei Fällen verlangt werden kann: bei Verschulden des Verbrauchers an der Verschlechterung der Sicherheit und - sondergewährleistungsrechtlich - bei nachträglichem Hervorkommen.
IV. Zur Verwertung der Liegenschaft bei hypothekarisch besichertem Kredit
Hat der Verbraucher der Bank zur Sicherung des Rückzahlungsanspruchs seine Liegenschaft verpfändet und kann er den Kredit nicht länger bedienen, muss die Bank vor Verwertung der Liegenschaft einen entsprechenden Titel gegen den Verbraucher erwirken. Die Bank muss daher entweder auf Bezahlung der fälligen Forderung klagen (Schuldklage) und kann erst anschließend aufgrund des stattgebenden Urteils Exekution in das gesamte Vermögen ihres Schuldners führen. Oder sie kann die Pfandrechtsklage (Hypothekarklage) anstrengen, die auf Bezahlung der Pfandforderung bei sonstiger Zwangsvollstreckung in die Pfandsache lautet. Erst mit dem gegen den Verbraucher erwirkten Exekutionstitel kann es zur Verwertung der Liegenschaft kommen.
Der Verbraucher hat daher stets die Möglichkeit, im Prozess neben etwaigen Einwendungen gegen die Rechtmäßigkeit des Pfandrechts (zB Unwirksamkeit des Pfandbestellungsvertrags) auch alle Einwendungen gegen die besicherte Forderung geltend zu machen.
Die Verwertung der Liegenschaft erfolgt entweder durch Zwangsverwaltung (§§ 97 ff EO) oder durch Zwangsversteigerung (§§ 133 ff EO). Letztere ist grundsätzlich eine gerichtliche Feilbietung (§ 461 ABGB). Eine außergerichtliche Verwertung gem §§ 466a ff ABGB scheidet bei Liegenschaften aus. Umstritten ist, ob die außergerichtliche Verwertung durch freihändigen Verkauf wirksam vereinbart werden kann (vgl § 1371 ABGB).