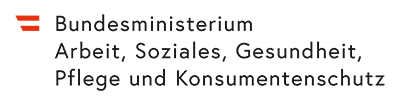- Das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz sinkt dramatisch[1].[2]
Das hat sicher mit der realen oder vermuteten Untätigkeit bei glamourösen Verfahren zu tun, wohl aber auch mit negativen Erfahrungen, die viele Konsumenten im persönlichen Umgang mit der Justiz machen müssen.[3] - Verbraucher erleben, dass viele gute materielle Rechte nur auf dem Papier stehen - gerichtlich durchsetzbar sind sie nicht.
Wer würde wegen eines mangelhaften Handys im Wert von 90 Euro ein Gerichtsverfahren mit einem Kostenrisiko von 10.000 Euro eingehen wollen[4];[5] - Es fehlen weitgehend funktionierende Streitbeilegungseinrichtungen für typische Verbraucherprobleme mit kleinen Streitwerten.[6]
- Die Finanzkrise 2008 hat wie ein Katalysator massenhafte Probleme im Bereich der Finanzdienstleistungen offenbart.
In den Boom-Jahren ab Mitte der Neunziger-Jahre hat die Politik die Menschen gezielt verunsichert, ob die Pensionen wohl gesichert seien und der Markt hat tausende Kleinanleger vom konservativen Sparbuch zu vermeintlich "ebenso sicheren", aber ertragreicheren Finanzprodukten gelockt. Waghalsige Veranlagungen finanziert durch Fremdwährungskredite wurden kleinen Sparern als "anlegergerecht" verhökert. Viele kleine Sparer haben so Ihr kleines Vermögen verloren bzw sich in existenzgefährdende Schulden gestürzt.[7] - Tausende Finanzkeiler haben sich mit Provisionen ein Vermögen verdient[8]. Diese Provisionen und auch noch der den Verkauf anheizende Strukturvertrieb waren Ursache für tausende Fehlberatungen. In Deutschland wird der Schaden aus Fehlberatungen auf 20 - 30 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.[9]
- Der Staat hat die kleinen Sparer nicht nur nicht ausreichend geschützt[10], sondern versagt nun auch bei der Aufarbeitung der Schäden in Gerichtsverfahren.
- Die Gerichte sind mit Massenverfahren überfordert, weil die Politik bis heute keine Vorsorge getroffen hat, solche Verfahren geordnet durchzuführen.
Im Zuge der Sammelklagen gegen die Sparkasse Salzburg im Zuge des WEB-Skandales[11] hatte der Justizausschuss einstimmig das Justizministerium aufgefordert, Verfahrensvorschriften für Massenverfahren zu entwickeln. Seit 2007 liegt ein Entwurf für Gruppenklagen und Musterprozesse in den Schubladen des Ministeriums. Trotz der Absichtserklärungen der beiden letzten Regierungen in den Regierungsprogrammen gibt es bis heute keinerlei Initiative, diese Vorschläge umzusetzen. - Die vom VKI entwickelte Sammelklage nach österreichischem Recht[12] ist nur eine - wenn auch bedingt taugliche - Krücke, Massenverfahren ökonomisch zu führen.
In den Sammelklagen gegen den AWD[13] warten die Geschädigten seit Jahren darauf, endlich zu den erhobenen Vorwürfen einvernommen zu werden. Stattdessen wird seit Jahren um Vorfragen - ob hier Sammelklagen zulässig seien[14] und ob man in Österreich Prozessfinanzierung gegen Erfolgsquote[15] betreiben dürfe - prozessiert. Wenn diese Fragen im Sinn des VKI erledigt sein werden, fragt sich dennoch, wann mit materiellen Entscheidungen zu rechnen sein wird. Wenn die Gerichte - wie bisher - alle halben Jahre einen Verhandlungstag ausschreiben, dann dauert es 1250 Jahre, bis alle Fälle erledigt sein werden. - Der grenzüberschreitende Einsatz der Sammelklage wird durch eine Judikatur des EuGH zum Verbrauchergerichtsstand[16] behindert. Wenn Verbraucher Ansprüche abtreten, dann verlieren sie den Vorteil, im eigenen Land klagen zu können.
Der EU-Kommission und dem österreichischen Justizministerium muss dieses Problem seit 2005 bekannt sein. Bis heute hat man die Normen nicht verändert. Es bräuchte einfach die Klarstellung, dass eine Abtretung an einen Verbraucherverband nicht zum Verlust des Gerichtsstandes führen soll.
Die Verfolgung von Schadenersatzansprüchen von 70 Frauen aus Österreich, die durch schadhafte Brustimplantate eines Herstellers in Frankreich massive Körperschäden erlitten haben, wird durch diese Situation massiv behindert.[17] - Eine weitere Lücke besteht bei Bagatell- und Streuschäden.
Seit 1.1.2009 legt das Zahlungsdienstegesetz sehr klar fest[18], dass ein besonderes Entgelt für Zahlscheinzahler nicht gerechtfertigt ist. Dennoch verlangen viele Unternehmen vieler Branchen solche Entgelte. Der VKI hat gegen Mobilfunker eine Reihe von Verfahren in den Unterinstanzen gewonnen[19]. Nun liegt die Frage aber - zur Vorabentscheidung[20] - beim Europäischen Gerichtshof.
Derweilen kassieren die Unternehmen weiter. Sollte nun in ein bis zwei Jahren eine endgültige Entscheidung gegen diese Entgelte rechtskräftig werden, dann haben die Unternehmen massenhaft über Jahre Unrechtsgewinne vereinnahmt, die sie - außer in Einzelfällen - kaum wieder herausgeben werden müssen. Mittel, diese Gewinne abzuschöpfen, gibt es nicht. - Wir betreiben - hier in Österreich - ein Rechtssystem, das - mangels wirksamer Mittel zur Durchsetzung von Schadenersatz bei Massenschäden bzw mangels Gewinnabschöpfung bei Streuschäden, durchaus Anreize für Unternehmen gibt, Gesetze zu missachten und sich gegenüber gesetzeskonformen Mitbewerbern Vorteile zu verschaffen.
Es gibt keine wirksamen Methoden, den Unrechtsgewinn aus einem Gesetzesverstoß wieder abzuschöpfen und damit den Verstoß von vorneherein als riskant erscheinen zu lassen. Pointiert gesagt: Der "Schwarzfahrer" in der Wirtschaft risikiert, wird er erwischt, nicht einmal die Zahlung des Fahrgeldes. Wer da noch freiwillig Fahrgeld zahlt, handelt geradezu gegen die eigenen ökonomischen Interessen. [21] - Die Ablehnung der "amerikanischen Verhältnisse" durch die Wirtschaft versteinert diese Situation. "Strafschadenersatz", "vorprozessuale Ermittlungsverfahren", "Erfolgsquoten für Anwälte" werden verteufelt, aber es werden keine adäquaten anderen Mittel gegen das massive Marktversagen entwickelt bzw zugelassen.
- In den Diskussionen um die Gruppenklage in Österreich wurde auch argumentiert, dass die Zivilprozessordnung Kostenbarrieren enthalte, um nicht jeden Anspruch vor Gericht gebracht zu sehen. Dieses Argument nimmt - im Lichte der Massenschäden etwa am Kapitalmarkt - in Kauf, dass die Mehrheit der Geschädigten[22] sich eine Rechtsdurchsetzung nicht leisten kann. Die Wirtschaft argumentiert damit, dass dies auch so bleiben soll. Recht also nur für jene, die es sich leisten können?
- Das Justizministerium stellt sich - im Internet - als "gut geführtes Unternehmen" dar.[23] Diese Sicht ist völlig verfehlt. Denn als gut geführtes Unternehmen wäre ja Gewinnmaximierung des Ziel. Also viele Gebühren kassieren[24] und möglichst wenig dafür leisten. Das kann nicht die Aufgabe der Justiz im Rechtsstaat sein[25]. Vielmehr muss der Rechtsstaat eine geordnete Rechtsdurchsetzung garantieren - auch wenn diese Steuergelder kostet - um die Selbsthilfe - zu Recht - hintanzuhalten.
- Was ist also zu tun, um den Rechtsstaat zu stärken?
- Ziel darf nicht sein, ein "profitables Unternehmen" zu führen, sondern es muss das Ziel sein, dass materielles Recht auch wirksam (rasch und kostengünstig) durchgesetzt werden kann.
- Wir brauchen im Verbraucherrecht als Alternative zu aufwendigen Gerichtsverfahren rasche und niederschwellige Formen der Schlichtung, ohne den Rechtsweg als ultima ratio auszuschließen.
- Wir brauchen wirksame Massenverfahren, die auch in überschaubarer Zeit zu Urteilen kommen können.
- Wir brauchen Anreize für die Wirtschaft, den bewußten Gesetzesverstoß zu vermeiden. Das bedeutet Abschöpfung des Unrechtsgewinnes, Anreize für Verbände zur Klagsführung, Strafschadenersatz und vieles mehr.
[1] 8 % "uneingeschränktes" Vertrauen / 21 Prozent "eher kein" oder "kein" Vertrauen (Umfrage RA-Kammer NÖ - Zitat Standard 3.7.2011); Vertrauensverlust in Justiz von minus 19 Prozent gegenüber 2011 (APA-OGM-Vertrauensindex 16.3.2012).
[2] Es ist erfreulich, dass andererseits die Verbraucher den VKI bei Umfragen als jene Organisation sehen, die am meisten für Gerechtigkeit steht (Standard 25.2.2012).
[3] An erster Stelle kommt da sicherlich die immer längere Verfahrensdauer; aber auch steigende Kosten für Gerichtsgebühren (etwa auch die Kopierkosten), der Umgang mit VerbraucherInnen in den Verfahren und vieles mehr dürfte eine Rolle spielen.
[4] BGHS Wien 3.8.2007, 19 C 44/06v (Musterprozess der AK Wien um Mängeln bei Mobiltelefon)
[5] Bei den meisten Verbraucherstreitigkeiten (bis rund 10.000 Euro Streitwert) beträgt das Kostenrisiko oft das Doppelte des Streitwertes. Das können sich Konsumenten ohne Rechtsschutzversicherung nicht leisten. Nun verfügen aber nur rund ein Viertel bis maximal ein Drittel aller Konsumenten über eine solche Versicherung. Die Verfahrenshilfe entschärft dieses Problem nur unzureichend - schließlich muss man im Fall des Prozessverlustes jedenfalls die Kosten der Gegenseite tragen.
[6] Eine gewisse Ausnahme stellt die Schlichtung der RTR im Bereich Telekommunikation dar.
[7] Siehe zB Fälle in der Sendung "Bürgeranwalt" vom 19.5.2012 und 26.5.2012 sowie "Ein Fall für Resetarits" vom 18.5.2012.
[8] Carsten Maschmeyers AWD ging 2000 an die Börse und Maschmeyer konnte den AWD rechtzeitig vor der Krise im Jahr 2007 für 1,2 Milliarden Euro (Handelsblatt 7.12.2011) an den schweizer Versicherungskonzern Swiss Life verkaufen. Er wurde der größte Einzelaktionär der Swiss Life und saß bis November 2011 im Verwaltungsrat. Dort ist er ausgeschieden, als bekannt wurde, dass die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn und den AWD Ermittlungen führt.
[9] Zitat aus der Studie "Anforderungen an Finanzvermittler - mehr Qualität, bessere Entscheidungen" des Deutschen Verbraucherschutzministeriums aus September 2008.
[10] Der Staat hat vielmehr sogar die Amtshaftung für Fehler der Finanzmarktaufsicht gegenüber Sparern und Anlegern ausgeschlossen (Standard 10.11.2008). Die Anlegerentschädigung wurde so kompliziert geregelt, dass jeder Anspruchsfall zum Streitfall wird (LGZRS Wien 3.04.2012, 58 Cg 186/11s; HG Wien 5.04.2012, 19 Cg 125/11w). Die Finanzmarktaufsicht prüft die Finanzdienstleister - was deren Wirken gegenüber Verbrauchern betrifft - höchst formal anhand der übermittelten Unterlagen. Diese sind natürlich idR gesetzeskonform gestaltet. Doch das ist nur der Schein einer ordentlichen Beratung. Denn viel wirksamer ist - in der Beratung durch Verwandte und Bekannte - die beim Strukturvertrieb angeheuert haben - das mündliche Gespräch. Diese Zusagen weichen in vielen Fällen völlig diametral von den schriftlichen Unterlagen ab, die als "notwendige Formalität" zur ungelesenen Unterschrift unterschoben werden. Das WAG entpuppt sich daher in der Praxis als "Anlageberaterschutzgesetz".
[11] Führende Mitarbeiter der Bank waren als Beitragstäter verurteilt worden. Mehr als 3000 Geschädigte verlangten von der Bank Schadenersatz.
[12] Geschädigte Verbraucher treten ihre Ansprüche dem VKI zum Inkasso ab und der VKI klagt diese in Form der Klagenhäufung gemäß § 227 ZPO gesammelt ein.
[13] 5 Sammelklagen für rund 2500 Geschädigte mit einem Streitwert von rund 40 Mio Euro sind seit 2009/2010 beim Handelsgericht Wien anhängig. Der Vorwurf: Systematische Fehlberatung von kleinen Sparern bei der Vermittlung von Aktien der Immofinanz und Immoeast.
[14] SK I: HG Wien 16.11.2009, 43 Cg 81/09y; SK II: HG Wien 14.9.2010, 47 Cg 77/10s; SK III: HG Wien 7.7.2010, 48 Cg 86/10x; SK IV: HG Wien 28.10.2010, 49 Cg 92/10m; SK V: 24.9.2010, 47 Cg 89/10 f.G Wien 28.10.2010, 49 Cg 92/10m; SK V: HG Wien 24.9.2010, 47 Cg 89/10f.
[15] HG Wien 17.12.2011, 47 Cg 77/10s.
[16] Artikel 15 Brüssel I Verordnung - EuGH: Rs C-89/91 Shearson Lehman Hutton, Slg 1993, I-139
[17] Der französische Hersteller ist im Konkurs. Nach französischem Recht besteht eine Pflichthaftpflichtversicherung. Diese wäre zu klagen. In Form einer Sammelklage nach österreichischem Recht geht das in Österreich dzt nicht.
[18] § 27 Abs 6 ZaDiG
[19] Orange: HG Wien 3.2.2011, 39 Cg 11/10a; T-Mobile: OLG Wien 25.01.2011, 4 R 209/10z; Hutchinson: HG Wien 4.10.2010, 22 Cg 8/10k; Mobilkom: HG Wien 27.08.2010, 30 Cg 29/10g; Financelife: HG Wien 20.1.2011, 18 Cg 152/10g .
[20] OGH 8.11.2011 10 Ob 31/11y
[21] Kletecka, Punitive damages - Der vergessene Reformpunkt?, ÖJZ 2008/83.
[22] In der Regel verfügt nur etwa ein Drittel der Geschädigten über eine Rechtsschutzversicherung. Die Rechtsschutzversicherungen haben nunmehr gewisse Ansprüche rund um Kapitalanlagen aus dem Vertragsrechtsschutz ausgenommen.
[23] Internetseite des BMJ: "Die österreichische Justiz leistet als moderne und innovative Organisation einen unverzichtbaren Dienst an der Gesellschaft. Als "Großunternehmen" weist sie einen "Jahresumsatz" von rund 1,1 Mrd. Euro auf und beschäftigt rund 11.700 Mitarbeiter. Der Blick auf die Einnahmen beweist, dass die Justiz ein effizient geführtes Unternehmen ist: rund 73 Prozent der Ausgaben sind durch Einnahmen abgedeckt. Dabei ist zu bedenken, dass die Justiz auch Aufgaben (z.B. im Bereich des Strafvollzugs) erfüllt, aus denen naturgemäß keine Einnahmen erwirtschaftet werden können."
[24] Kronenzeitung 12.11.2010 "Bis 83% höhere Kosten - Raubrittertum bei Gebühren in der Justiz"
[25] "Wirtschaftliche Gesichtspunkte .... sind aber verfehlt, wenn sie dazu führen, dass die Justiz als Einnahmensquelle des Staates gesehen wird, die bestimmte Leistungen zu bestimmten Preisen = Gebühren anbietet und deren Zeil es ist, möglichst viel für das Staatsbudget zu erwirtschaften" (Hon.-Prof. Dr. Irmgard Griess, Präsidentin i.R. des OGH, 40. Europäische Präsidentenkonferenz in Wien: "Justiz in Gefahr - Was tun?" 17.2.2012)