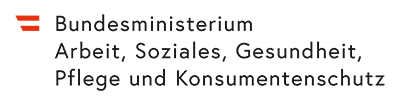Konkret ging es um folgende Klauseln:
1) Die Vertragsdauer sowie die Kündigungsbestimmungen werden in Übereinstimmung mit § 15 Abs 3 KSchG wie folgt vereinbart:
Der Wärmelieferungsvertrag wird grundsätzlich auf die Dauer des Mietverhältnisses zwischen dem Großkunden und dem Kunden geschlossen und ist während dieser Zeit - unbeschadet von Punkt VII.1 - beiderseits unkündbar. Er endet jedenfalls mit dem Mietverhältnis sowie mit dem Ende des Vertrages zwischen dem Großkunden und Fernwärme Wien. Der Vertrag kann vom Kunden nur gleichzeitig mit dem Mietvertrag aufgekündigt werden.
2) Im Falle von Wohnungseigentum wird der Vertrag auf die Dauer des Eigentumsrechts des Kunden am Nutzungsobjekt abgeschlossen und ist während dieser Zeit - unbeschadet von Punkt VII.1 - beiderseits unkündbar. Er kann vom Kunden nur bei gleichzeitiger Übertragung des Eigentumsrechts aufgekündigt werden und endet jedenfalls bei Erlöschen des Eigentumsrechts sowie bei Auflösung des Vertrages zwischen der Eigentümergemeinschaft und Fernwärme Wien.
3) Bei Änderung der Besitz-, Eigentums- oder Miteigentumsverhältnisse hat der Kunde dafür zu sorgen, dass der Nachfolger in die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag eintritt. Innerhalb eines Monats, nachdem dies geschehen ist und der Veräußerer der Fernwärme Wien eine schriftliche Mitteilung gemacht hat, erlischt die Haftung aus diesem Vertrag.
Die dritte Klausel beurteilte der OGH als gröblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB, weil der Verbraucher, der die Wohnung aufgibt, bei sonstiger Weiterhaftung die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf seinen Nachfolger überbinden muss. Ist der Nachfolger dazu nicht bereit, führt das dazu, dass der Verbraucher weitere Kosten zu tragen hat, obwohl er die Wohnung gar nicht mehr bewohnt.
Nach der ersten und zweiten Klausel sollte der Vertrag für die Dauer des Mietverhältnisses bzw. für die Dauer des Eigentumsrechtes unkündbar sein.
Wir haben darin einen Verstoß gegen § 15 Abs 3 KSchG gesehen. Gemäß § 15 Abs 3 KSchG können den Umständen angemessene, vom Absatz 1 und 2 abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen nur dann vereinbart werden, wenn die Erfüllung des Vertrages erhebliche Aufwendungen des Unternehmers erfordert. In den AGB der Fernwärme Wien findet sich zwar ein Hinweis auf "erhebliche Aufwendungen" , allerdings - so meinten wir - reicht die bloße Behauptung besonderer Aufwendungen ohne diese nach Art und Umfang nachvollziehbar darzulegen, nicht aus. Vielmehr hat der Unternehmer dem Verbraucher die Mehrleistung genau zu erklären. Fehlt eine solche Konkretisierung, so kann der Wärmeliefervertrag eben nur unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 2 Monaten zum ersten Vertragsjahr und danach jeweils zum Halbjahr ( § 15 Abs 1 KSchG) gekündigt werden.
Zu den ersten beiden Klauseln stellte der OGH klar, dass längere Vertragsbindungen nur unter der Voraussetzung zulässig sind, dass der Energieversorger erhebliche Aufwendungen getragen hat, die dem Betroffenen bei der Vertragsschließung bekannt gegeben werden. Vage, globale Hinweise des Energieversorgers reichen jedenfalls nicht aus. Zweck der Regelung sei nämlich, dem Verbraucher eine Beurteilung der Angemessenheit der von ihm einzugehenden Bindung zu ermöglichen. Die bloße Mitteilung erheblicher Aufwendungen hätte bloße Alibifunktion und widerspreche dem Zweck dieser Regelung.
Doch selbst die korrekte Bekanntgabe der Aufwendungen - so der OGH - sei kein Freibrief für den Energieversorger, Bindungsfristen zu vereinbaren, die - wie im vorliegenden Fall - bei dauerndem Verbleib in der Wohnung auf eine lebenslange Bindung hinauslaufen können.
Da in den Verträgen der Fernwärme Wien nur ganz allgemein auf den Umstand "erheblicher Aufwendungen" verwiesen wurde, diese in weitere Folge aber nicht dargestellt wurden, können solche Verträge nach § 15 Abs 1 KSchG unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, danach zum Ablauf jeweils eines halben Jahres gekündigt werden.
Auch aus dem Heizkostenabrechnungsgesetz infolge Ausscheidens eines Mieters konnte die Gegenseite nichts für ihren Prozessstandpunkt gewinnen. Das Heizkostenabrechnungsgesetz sei jedenfalls keine Spezialnorm, welche das KSchG verdrängen würde. Der OGH ging somit auch nicht darauf ein, welche Auswirkungen das Ausscheiden eines Mieters auf die Heizkostenabrechnung hat.
Der OGH stellte auch klar, dass sich die Fernwärme Wien nicht auf Vertragsbeziehungen zwischen dem Mieter/Wohnungseigentümer und dem Vermieter bzw. der Wohnungseigentümergemeinschaft berufen könne. Selbst wenn dort eine Verpflichtung zum Anschluss an die Fernwärmeversorgung vereinbart sei, könne der Fernwärmevertrag nach § 15 KSchG gekündigt werden.
Offen blieb die Frage, ob eine zulässige Kündigung des Fernwärmeliefervertrages allenfalls einen Verstoß gegen mietvertragliche Bestimmungen darstellen könnte. Laut Univ.-Prof. Schauer, der sich kürzlich zu dieser Rechtsfrage zu Wort meldete ( wobl 2004,133), sollen entsprechende Vertragsbindungen in Mietverträgen bzw. Kaufverträgen ebenfalls den Regelungen des § 15 KSchG in analoger Anwendung unterliegen. Eine Kündigung des Fernwärmeliefervertrages sollte daher keine nachteiligen Folgen aus dem Eigentums- oder Mietvertrag nach sich ziehen. Diese Rechtsfrage ist jedoch noch nicht geklärt. Auch dazu wird man einen Musterprozess führen müssen.
OGH 29.4.2004, 8 Ob 130/03f
Klagevertreter: Dr. Stefan Langer und Dr. Anne Marie Kosesnik-Wehrle, RA in Wien