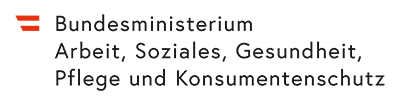Die Beklagte betreibt eine Bank und bietet ihre Leistungen bundesweit an. Sie verwendet im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die sie von ihr geschlossenen Verträgen zugrunde legt, und in Vertragsformblättern mit der Bezeichnung „Kontopreisblatt“ („Die Konten der Bank *, Stand Juni 2023“) die Klauseln:
„- Habenzinsen 0,000 % p.a.“
- „vereinbarter Sollzinssatz (derzeit 12,500 % p.a.4) + 3,000 Prozentpunkte“
- „4) Zinsbindungsklausel: Der Sollzinssatz ist gebunden an den 3-Monats-EURIBOR (= Euro Interbank Offered Rate/3 Monate), kaufmännisch gerundet auf volle 0,125 %, zuzüglich eines Aufschlages von 9 Prozentpunkten. Eine Anpassung des Sollzinssatzes erfolgt jeweils am 1.3., 1.6., 1.9. und 1.12. des Jahres. Maßgeblich für die Zinssatzfestsetzung ist der am 2. Bankwerktag vor dem jeweiligen Anpassungsstichtag geltende 3-Monats-EURIBOR.“
Der OGH entschied wie folgt:
Rechtliche Beurteilung
[…]
II. Zu den bekämpften Klauseln
1. Zur Reichweite des Klagebegehrens
[18] Wie bereits das Erstgericht richtig ausführte, ist schon das Klagebegehren undeutlich gefasst, weil der Kläger in seinem Klagebegehren keine Einschränkung auf bestimmte Produkte der Beklagten vornimmt. Der Kläger verwendet noch in seiner Revision einerseits die Begriffe „Verbraucherzahlungskonto“, womit offensichtlich Zahlungskonten iSd § 2 Z 3 Verbraucherzahlungskontogesetz (BGBl I 2026/35, im Folgenden: VZKG) gemeint sind, sowie „Girokonto“. Nachdem dem Klagebegehren ohnehin keine Berechtigung zukommt, braucht auf diesen Umstand und die Frage, ob dem Klagebegehren eine deutlichere Fassung zu geben wäre (vgl RS0039357), nicht mehr näher eingegangen werden.
2. Zur Frage der Haupt- oder Nebenleistungspflicht
[19] 2.1. Die Richtlinie 93/13/EWG vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (Klausel-RL) bezweckt gemäß ihrem Art 1 Abs 1 die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über missbräuchliche Klauseln in Verträgen zwischen Gewerbetreibenden und Verbrauchern.
[20] Nach Art 4 Abs 2 Klausel-RL betrifft die Beurteilung der Missbräuchlichkeit der Klauseln weder den Hauptgegenstand des Vertrags noch die Angemessenheit zwischen dem Preis bzw dem Entgelt und den Dienstleistungen bzw den Gütern, die die Gegenleistung darstellen, sofern diese Klauseln klar und verständlich abgefasst sind. Als Grundregel ist der Vorschrift zu entnehmen, dass transparent formulierte Klauseln, die den Preis oder den Umfang der Hauptleistungspflichten festlegen, von der Missbräuchlichkeitskontrolle nach Art 3 Klausel-RL freigestellt sind. Insbesondere sind die Leistungsbeschreibung und das von den Parteien vertraglich festgelegte Äquivalenzverhältnis von der Missbrauchskontrolle prinzipiell ausgenommen (siehe jüngst 7 Ob 169/24i Rz 20 mwN).
[21] Nach der Rechtsprechung des EuGH sind unter den Begriff „Hauptgegenstand des Vertrages“ iSd Art 4 Abs 2 der Klausel-RL diejenigen Klauseln zu fassen, die seine Hauptleistungen festlegen und ihn als solche charakterisieren sowie das Wesen des Vertragsverhältnisses selbst definieren (vgl ua C-26/13, Kásler und Káslerné Rabai, Rn 49 f; C-96/14, Van Hove, Rn 33; C-609/19, BNP Paribas Personal Finance SA, Rn 29). Es haben somit die nationalen Gerichte die Entscheidung, in welche Kategorie eine Klausel fällt, grundsätzlich unter Berücksichtigung der Natur, der Systematik und der Bestimmungen eines Vertrags sowie seines rechtlichen und tatsächlichen Kontextes zu treffen. Allerdings ergeben sich aus der jüngeren Rechtsprechung des EuGH europäisch-autonome Kriterien, auf deren Grundlage die Abgrenzung zu erfolgen hat (vgl dazu ausführlich hinsichtlich diverser Klauseln in Verbraucherkrediten 7 Ob 169/24i Rz 21 ff, insbesondere Rz 27).
[22] 2.2. Ein Girovertrag ist eine Vereinbarung zwischen einer Bank und einem Kontoinhaber, durch die sich die Bank verpflichtet, ihr aufgetragene Leistungen, die dem bargeldlosen Zahlungsverkehr dienen, also die Gutschrift eingehender Beträge, die Besorgung von Überweisungen, die Entgegennahme von Einzahlungen auf das Konto und die Leistung von Zahlungen zu Lasten des Kontos, durch buchmäßige Umschreibungen zu bewirken; das Kreditinstitut ist nur nicht verpflichtet, einer Disposition, durch die das Konto ins Debet kommt, zuzustimmen (RS0032931). Mittlerweile umfassen die vertraglichen Leistungen von Girokonten auch regelmäßig die Erbringung weiterer Zahlungsdienste, wie etwa Zahlungsvorgänge mittels Zahlungskarten, die Ausführung von Lastschriften und die Ein- und Auszahlung von Bargeld (vgl § 1 Abs 2 Z 1 bis 4 ZaDiG 2018; Rabl/Herndl, Entgelte im Girokontovertrag, ÖBA 2024, 195 f).
[23] Wesentliches Charakteristikum eines Girokontovertrages ist somit die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und nicht der Anspar- oder Anlagezweck. Dafür stehen zum Beispiel Spareinlagen zur Verfügung, die durch eine gewisse längerfristige Dauer und den Veranlagungszweck der Verzinsung gekennzeichnet sind, typischerweise
Vermögensbildungs- und Gewinnerzielungsfunktion haben und bei denen eine „Nullverzinsung“ nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs den elementaren und gesetzlich angelegten Zwecken einer Spareinlage (Gewinn- und Vermögensbildungsfunktion) diametral widerspricht (RS0125504).
[24] 2.3. Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs handelt es sich beim Vertrag über die Führung eines Girokontos um einen Vertrag sui generis mit Elementen des Darlehens und eines unregelmäßigen Verwahrungsvertrags (2 Ob 339/01v mwN; RS0010928 [T2]; so auch Rabl/Herndl, ÖBA 2024, 197 mwN).
[25] Räumt die kontoführende Bank ihrem Kunden weiters einen Rahmen ein, innerhalb dessen er Zahlungsaufträge erteilen kann, die sein aktives Guthaben übersteigen („Überziehungsrahmen“), und bei dessen Ausnutzung Sollzinsen anfallen, wird der Girokontovertrag um eine Kreditabrede iSd § 988 Satz 1 2. Halbsatz ABGB erweitert.
[26] Dies steht auch mit der Definition des VZKG in Einklang: Demnach ist gemäß § 2 Z 25 VZKG unter „Überziehungsmöglichkeit“ ein ausdrücklicher Kreditvertrag, bei dem ein Zahlungsdienstleister dem Verbraucher Beträge zur Verfügung stellt, die das aktuelle Guthaben auf dem laufenden Zahlungskonto des Verbrauchers überschreiten, zu verstehen. Dies entspricht im Übrigen auch der Regelung des § 18 Abs 1 VKrG.
[27] 2.4. Im vorliegenden Fall verrechnet die Beklagte ein monatliches Entgelt für die Kontoführung (siehe dazu das vom Kläger vorgelegte Vertragsformblatt der Beklagten, welches als unstrittige Urkunde der Entscheidung des Revisionsgerichts ohne Weiteres zugrunde gelegt werden kann, RS0121557 [T3]).
[28] 2.5. Das Girokonto (= Bankkonto) ist praktisch der wichtigste Anwendungsfall des Kontokorrent gemäß §§ 355 ff UGB (Apathy, Das Kontokorrent, in Apathy/Iro/Koziol, Österreichisches Bankvertragsrecht II², Rz 2/1).
[29] 2.5.1. Ein Kontokorrentverhältnis setzt eine – auch in schlüssiger Form mögliche – Vereinbarung voraus, nach einer gewissen Zeitperiode alle aus der Geschäftsverbindung entspringenden beiderseitigen Ansprüche und Leistungen abzurechnen und für das sich daraus für eine Partei ergebende Guthaben eine von den einzelnen Posten unabhängige Forderung zu begründen (RS0033381). Ein Kontokorrentverhältnis setzt nicht voraus, dass auf beiden Seiten Forderungen entstehen müssen (RS0062373).
[30] 2.5.2. Das Girogeschäft ist die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abbuchungsverkehrs in laufender Rechnung (RS0032931 [T5]). Es geht daher um die Verrechnung gegenseitiger Forderungen und Leistungen in eine buchhalterisch zusammengefasste Form, bei der der sich ergebende Saldo eine Forderung des einen Partners gegen den anderen darstellt (9 Ob 9/17i ErwGr 1). Die Bank übernimmt durch den Kontoführungsvertrag die Verpflichtung, in regelmäßigen
Zeitabständen Rechnungsabschlüsse durchzuführen, den Saldo zu ermitteln und mit dem Anbot auf einvernehmliche Feststellung dem Kunden bekannt zu geben (RS0052409; 9 Ob 9/17i ErwGr 1). Ein unter Einschluss der AGB der Kreditinstitute abgeschlossener Girovertrag begründet ein Kontokorrentverhältnis (4 Ob 36/06g).
[31] 2.5.3. Im Fall des Bankkontokorrents wird die Saldoforderung als neuer Rechnungsposten der folgenden Rechnungsperiode vorgetragen (6 Ob 530/84 SZ 57/66, Apathy in BVR II² Rz 2/1, 2/30). Zudem kann der Kunde jederzeit über sein Kontoguthaben frei verfügen und erfolgt beim Bankkontokorrent die Berechnung etwaiger Haben- oder Sollzinsen aufgrund eines rechnerischen Zwischensaldos (Tagessaldo), der bei jeder Kontobewegung neu gebildet wird (Rabl/Herndl, ÖBA 2024, 200; Apathy in BVR II² Rz 2/56).
[32] 2.5.4. Die in das Kontokorrent einbezogenen Ansprüche können verzinslich sein, brauchen es aber nicht zu sein (2 Ob 617/84; Apathy in BVR II² Rz 2/55 mwN). Die Zinspflicht kann sich auf das Gesetz oder eine Vereinbarung stützen (§ 1000 Abs 1 ABGB). Eine vertragliche Vereinbarung von Habenzinsen liegt hier insofern vor, als diese mit fix 0 % vereinbart sind. Gegen die vertragliche Festsetzung der Habenzinsen mit 0 % wendet sich der Kläger ohnehin nicht.
[33] 2.6. Hauptleistungspflicht der Bank aus dem Girokontovertrag ist die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die Verwahrung von Guthaben, um die Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr für den Bankkunden zu ermöglichen. Dafür zahlt dieser ein Entgelt. Der Girokontovertrag dient nicht einem Sparzweck und ist nicht primär davon geprägt, dass das Guthaben zwingend zu verzinsen ist. Bei der Verzinsung von Guthaben auf Girokonten handelt es sich daher, auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH, um eine Nebenpflicht und nicht um eine Hauptleistung. Die Klausel unterliegt somit der Inhaltskontrolle des § 879 Abs 3 ABGB.
[34] 2.7. An dieser Beurteilung ändern auch die von der Beklagten angeführten und kürzlich vom deutschen BGH ergangenen Entscheidungen zur ua Unwirksamkeit von Klauseln zu Verwahrerentgelten („Negativzinsen“) in Verträgen über ua Girokonten (Urteile vom 4. Februar 2025, XI ZR 61/23, XI ZR 65/23, XI ZR 161/23 und XI ZR 183/23) nichts, ist doch die deutsche Rechtslage zum einen nur bedingt mit der österreichischen vergleichbar (siehe zur teilweise noch alten Rechtslage Koziol, Giroüberweisung und Lastschriftverfahren, in Apathy/Iro/Koziol, Österreichisches Bankvertragsrecht III2 Rz 1/22, Fn 98) und geht es zum anderen im vorliegenden Fall gerade nicht um ein zusätzlich zum Entgelt für die Kontoführung zu zahlendes Entgelt, das der Verbraucher für die Verwahrung seines Geldes an die Bank zu zahlen hat, sondern um die Frage, ob die beklagte Bank dem Kunden für das bei ihr verwahrte Geld Zinsen zu leisten hat.
3. Zur Frage der gröblichen Benachteiligung
[35] 3.1. Eine gröbliche Benachteiligung ist, wie bereits das Berufungsgericht richtig ausführte, zu verneinen, weil für die unterschiedlichen Soll- und Habenzinssätze bzw den Umstand, dass der Habenzinssatz fix bei 0 % und der Sollzinssatz an die Entwicklung des 3-Monats-Euribors mit einem Aufschlag von 9 % gebunden ist, eine sachliche Rechtfertigung gegeben ist, selbst wenn nach dem dispositiven Recht aufgrund des der Geschäftsvereinbarung zugrunde liegenden Kontokorrents nach § 355 Abs 4 UGB Zinsen für den Saldo verlangt werden können. Es liegt entgegen der Ansicht des Klägers keine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots oder eine Äquivalenzstörung vor, besteht doch kein auffallendes Missverhältnis zur vergleichbaren Rechtsposition des anderen (vgl RS0016914 [T4]):
[36] Die rechtliche Beurteilung der Verwahrung von Guthaben durch die Bank ist schließlich nicht mit jener des Kredits, den die Bank dem Kunden als Überziehungsrahmen gewährt, vergleichbar. Es mag sich zwar um ein einziges Vertragsverhältnis handeln, allerdings ist die Bank im Rahmen eines Girokontovertrages nicht verpflichtet, auch einen als Kreditvertrag einzustufenden Überziehungsrahmen zu gewähren. Zudem sind auch die Rechtspositionen nicht vergleichbar, weil der Verbraucher sein am Konto erliegendes Guthaben jederzeit beheben kann, die Bank somit auch stets Sorge dafür zu tragen hat, über ausreichend Liquidität zu verfügen, um dem Kunden sein Guthaben auszahlen zu können, während sie im Rahmen der Überziehungsmöglichkeit zudem dem Kunden ebenso stets eine entsprechende Geldsumme zur Verfügung stellen können muss. Die vereinbarten Sollzinsen für den Kreditvertrag sind somit rechtlich nicht vergleichbar mit allfälligen Habenzinsen für Guthaben auf dem Girokonto. Eine Äquivalenzstörung ist daher schon mangels vergleichbarer Rechtspositionen zu verneinen.
[37] 3.2. Es ist auch nicht gröblich benachteiligend, dass allfällige Früchte aus der Verwahrung bei der Beklagten verbleiben, liegt doch der Vorteil des Verbrauchers zum einen darin, dass er durch die Führung des Girokontos durch die Beklagte am Zahlungsverkehr teilnehmen kann, diese seine Zahlungsaufträge aufgrund eines Guthabens überhaupt durchführen kann und sein Guthaben bei dieser sicher verwahrt sowie aufgrund der gesetzlichen Einlagensicherung im Sinn des ESAEG auch gesichert ist. Dafür leistet er ein Entgelt (monatliches Kontoführungsentgelt). Der Vorteil der Bank liegt darin, dass sie zum einen dieses monatliche Kontoführungentgelt erhält und zum anderen unter Umständen die Früchte des verwahrten Geldes ziehen kann.
[38] Es steht dem Verbraucher im Übrigen frei, wenn er (höhere) Zinsen für sein Guthaben lukrieren will, sein Geld in einem entsprechend verzinsten Sparprodukt anzulegen.
[39] 3.3. Die vom Kläger zitierte Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu 4 Ob 179/02f ist schon deshalb nicht einschlägig, weil im dortigen Fall bestimmte Soll- und Habenzinsen vereinbart worden waren und die dort beanstandete Klausel Z 38 dazu führte, dass die tatsächliche Zinsenbelastung des Kunden bei einer Kontoüberziehung
wegen der anfallenden Zinseszinsen den vertraglich vereinbarten Zinssatz überstieg, während dies bei den vereinbarten Habenzinsen nicht der Fall war. Die dort zu prüfende Klausel unterlief somit die zwischen der Bank und dem Kunden getroffene vertragliche Zinsenvereinbarung zu Lasten des Kunden.
[40] 3.4. Im Übrigen liegt auch keine sonstige Abweichung vom dispositiven Recht vor, die zu einer gröblichen Benachteiligung führen würde:
[41] 3.4.1. Aus dem VZKG ist entgegen der Ansicht des Klägers keine gröbliche Benachteiligung durch die unterschiedliche Regelung von Soll- und Habenzinsen abzuleiten: § 8 Abs 1 Z 4 und 5 VZGK regeln lediglich, dass der Zahlungsdienstleister dem Verbraucher mindestens einmal jährlich und bei der Beendigung des Rahmenvertrags eine Entgeltaufstellung mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, die „gegebenenfalls den Sollzinssatz für das Zahlungskonto und den Gesamtbetrag der wegen einer Überziehung oder Überschreitung im Bezugszeitraum in Rechnung gestellten Zinsen“ und „gegebenenfalls den Habenzinssatz für das Zahlungskonto und den Gesamtbetrag der im Bezugszeitraum aufgelaufenen Zinsen“ zu enthalten hat. Bereits aus dem Wort „gegebenenfalls“ ist eindeutig abzuleiten, dass weder eine Pflicht zur Leistung von Habenzinsen nach diesem Gesetz besteht, noch ist aus der Bestimmung abzuleiten, dass ein Gleichklang zwischen Soll- und Habenzinsen bestehen müsste. Das Argument des Klägers, wonach die Einschränkung „gegebenenfalls“ nur dem Umstand Rechnung trage, dass in einem bestimmten Zeitpunkt deshalb keine Habenzinsen anfallen könnten, weil das Konto nie ein Guthaben aufgewiesen habe, geht ins Leere, ist doch nicht nur der Gesamtbetrag der angelaufenen (oder auch nicht angelaufenen) Zinsen anzuführen, sondern auch der Habenzinssatz. Dieser ist anzuführen unabhängig davon, ob Zinsen für ein Guthaben aufgelaufen sind oder nicht.
[42] 3.4.2. Auch das Argument der Revision, § 11 Abs 3 Z 1 und 2 VZKG ordne an, dass dem Verbraucher auf der Vergleichswebsite der Bundesarbeitskammer beim Entgeltvergleich die im Fall von Überziehungen oder Überschreitungen verrechnete jährliche Sollzinssatz sowie die für Guthaben auf dem Zahlungskonto gewährte jährliche Habenzinssatz, anzugeben seien und damit die Entgelte relevante Parameter für die Nachfrageentscheidung des Verbrauchers seien, geht ins Leere. Das VZKG regelt Informationen, die Zahlungsdienstleister einem Verbraucher über die für Zahlungskonten verlangten Entgelte erteilen müssen (§ 1 Z 1 leg cit). Inwiefern daraus abzuleiten wäre, dass Soll- und Habenzinsen vergleichbar geregelt sein müssen, ist nicht ersichtlich.
[43] 3.4.3. Ebenso ergibt sich aus der Einordnung des Girokontovertrags als Vertrag sui generis mit Elementen des Darlehens und der Verwahrung (siehe oben 2.2 ff) kein gesetzlich vorgesehener Anspruch auf Zinsen:
[44] Selbst wenn man ein Guthaben des Verbrauchers am Girokonto als Darlehen wertet (siehe die diesbezüglichen Bedenken bei Rabl/Herndl, ÖBA 2024, 196 mwN), spricht das mit Blick auf § 984 Abs 1 ABGB nicht gegen eine Unentgeltlichkeit. Ein Kreditvertrag, somit ein entgeltlicher Darlehensvertrag, bei dem der Verbraucher Kreditgeber wäre, ist hier zudem schon deshalb zu verneinen, weil der Verbraucher der Bank keinen Geldbetrag zum Abruf zur Verfügung stellen muss (vgl § 988 ABGB). Der Kunde muss vielmehr nicht einmal ein Guthaben auf seinem Konto haben, kann dieses jederzeit beheben und, im Fall der Einräumung eines als Kreditvertrags anzusehenden Überziehungsrahmens, sogar ins Minus gehen (siehe dazu ausführlicher Rabl/Herndl, ÖBA 2024, 196).
[45] Auch aus der Einstufung des Girokontovertrags als Vertrag sui generis mit Elementen eines unregelmäßigen Verwahrungsvertrags (vgl § 959 ABGB, wonach bei verbrauchbaren Sachen, von denen der Verwahrer Gebrauch machen darf, der Verwahrungsvertrag in einen Darlehensvertrag umgeändert wird) ist eine Pflicht der Bank zur Leistung von Zinsen für das am Konto befindliche Guthaben nicht ableitbar.
[46] 4. Die beanstandeten Klauseln halten somit einer Inhaltskontrolle stand und sind zulässig.
[47] 5. Der Kläger macht nur in eventu für den Fall, dass die Verzinsung von Guthaben auf einem Zahlungskonto als Hauptleistungspflicht der Bank anzusehen wäre, auch einen Verstoß nach § 879 Abs 1 ABGB geltend.
[48] Im Übrigen liegt weder ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot, noch gegen die guten Sitten vor. Die unterschiedliche Verzinsung von Guthaben und Debet ist, wie ausgeführt, sachlich gerechtfertigt. Es sind Sollzinsen für einen Kreditvertrag nicht mit allfälligen Habenzinsen für ein Guthaben auf einem Girokonto, das die Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr ermöglicht, vergleichbar.“
Klagsvertreter: Dr Stefan LANGER, RA in Wien